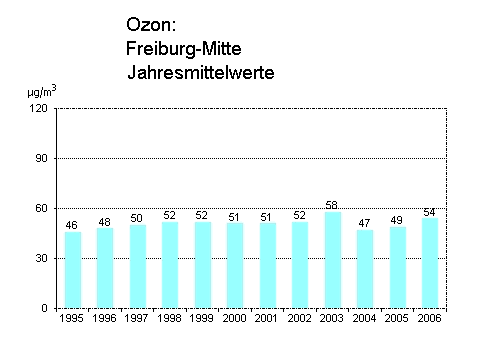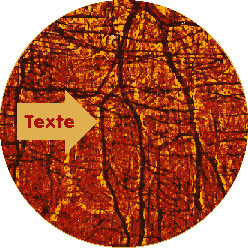Freiburg war einmal Ökohauptstadt
Den Titel "Umwelthauptstadt" führt Freiburg heute offiziell nicht mehr, obwohl es in den Mainstream-Medien nach wie vor häufig heißt, Freiburg sei Deutschlands Ökohauptstadt. 1992 - also vor 15 Jahren - wurde der Titel "Umwelthauptstadt" bei einem bundesweit von der 'Deutschen Umwelthilfe' (DUH) ausgeschriebenen Wettbewerb an Freiburg vergeben.
Bereits einige Jahre später wurde dieser Städte-Wettbewerb nicht mehr fortgesetzt. Statt dessen organisierte die DUH von 2001 bis 2004 einen Wettbewerb um den Titel "Zukunftsfähige Kommune". Im Jahr 2004 gewann Freiburg bei diesem Wettbewerb einen ersten Preis. Spätestens seit damals stagniert die umweltpolitische Entwicklung in Freiburg und auf etlichen Feldern ist Freiburg längst hinter anderen vergleichbaren Städten weit zurück gefallen.
In der "Solar-Bundesliga" beispielsweise ist Freiburg in den letzten Jahren hinter Ulm und Ingolstadt - in der Klasse der Städte über 100.000 EinwohnerInnen - auf den dritten Platz zurückgefallen. Die Solarbundesliga wird seit sieben Jahren von der 'Deutschen Umwelthilfe' und der Fachzeitschrift 'Solarthemen' veranstaltet.
Noch 2004 erhielt Freiburg den "Solarpreis". Doch die Vorzeige-Objekte sind längst Zeugen einer vergangenen sonnigeren Periode: der markante Solartower, die Intersolar, die Solarstromanlage am Dreisamstadion und der Neuen Messe, die Windanlage Schauinsland, Heliotrop, Ökostation, Solarfabrik, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) und die Solarsiedlung am Schlierberg. Seit Jahren ist nichts vergleichbares mehr nachgewachsen.
In Freiburg befinden sich lediglich 0,064 Quadratmeter thermische Solaranlagen pro Kopf. In Crailsheim sind es immerhin bereits ein Drittel Quadratmeter - also rund fünf mal so viel. Im Bayerischen Ort Kastl - Sieger der Solarbundesliga 2006 in der 3. Klasse der Kleinstädte finden sich rund 0,6 Quadratmeter thermische Solaranlagen pro Kopf - also rund zehn mal so viel wie in Freiburg.
Auch in der Wertung der photovoltaischen Solarzellen ist das bisher Erreichte in Freiburg nicht sonderlich beeindruckend: 45,4 Watt pro Kopf. In Crailsheim sind es rund 75, in Herxheim in Rheinland-Pfalz über 173 - also mehr als dreimal so viel. Und in der bereits genannten Kleinstadt Kastl über 745 Watt pro Kopf - mehr als 16-mal so viel wie in Freiburg.
Aber auch schon zu Zeiten, in denen Freiburg in der Klasse der Städte über 100.000 EinwohnerInnen noch Platz Eins erreicht hatte, lag die Stadt im Gesamtergebnis der Solarbundesliga auf Platz 148 - Ulm auf Platz 153. Ausnahmslos alle vorderen Plätze wurden von kleineren Städten und Gemeinden belegt.
Und entgegen dem immer noch weitverbreiteten Nimbus muß konstatiert werden, daß in Freiburg inzwischen vergleichsweise wenig Solartechnik produziert wird. "Längst hat sich in den neuen Bundesländern eine Solarwirtschaft aufgebaut, gegen die sich Südbaden nur noch als kleines Dorf ausnimmt", bilanzierte das Magazin 'Kommunal Intern' kürzlich.
Allein an diesen Ergebnissen läßt sich bereits ablesen, daß die Förderung erneuerbarer Energien zwar in den Sonntagsreden vorkommt, aber in Freiburg nicht sonderlich ernst genommen wird. Ein Beispiel wie es angepackt werden kann, liefert der "Vellmarer Weg", häufig auch als bottom-up-Politik bezeichnet: Eine politische Initiative, die von der Basis, von der Kommune ausging: Die Stadt Vellmar - in der Solar-Region Nordhessen - machte Solaranlagen bei Neubauten zur Pflicht und regte damit bundesweit Diskussionen über eine Solaranlagen-Verordnung an. Eine solche Verordnung ist beispielsweise im spanischen Katalonien bereits Wirklichkeit und in Niederöstererreich für Landesgebäude beschlossen. Und bei der deutschen Bundesregierung stößt sie auf taube Ohren.
Doch auch in Berlin sind nur die Oberen taub und blind für Solarenergie. Ausgerechnet der "rot-rote" Berliner Senat - sonst nicht gerade berühmt für umweltpolitische Einsichten - lockt die Solarbranche an. Ausschlaggebend sind denn auch wirtschaftspolitische Überlegungen. Harald Wolf, Wirtschaftssenator der Linkspartei erklärte im Juli, er habe "deutliche Signale" der Industrie dafür, daß die Zahl der Arbeitsplätze in der Produktion von Solaranlagen von derzeit 350 in den nächsten zwei Jahrenauf über 800 wachse. Die Förderung der hauptstädtischen Solarindustrie dient daher nicht allein dem Klimaschutz, sondern ist handfeste Industriepolitik. "Wir erwarten erhebliche Wachstumsschübe", freute sich Harald Wolf.
In Sachsen ist die Solar-Industrie bereits Bundesspitze. Während etwa in Sachsen bereits Fabriken Solarzellen produzieren, werkeln in der Hauptstadt vorwiegend Start-up-Unternehmen mit weniger als 10 MitarbeiterInnen. Nur im Verbund mit Brandenburg kann Berlin für sich beanspruchen, einer der vier wichtigsten Solar-Standorte in Deutschland zu sein - hinter Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Von der "Solarregio Freiburg" ist in diesem Zusammenhang schon lange nicht mehr die Rede. "Wir sprechen inzwischen schon vom Solar-Valley Ostdeutschland", sagt der Geschäftsführer des Branchenverbandes Solarwirtschaft, Carsten Körnig.
Unter den baden-württembergischen Städten gehört Heidelberg seit 15 Jahren zu den Vorreitern kommunalen Engagements für erneuerbare Energien. Heidelberg erhielt 2006 den von Eurosolar verliehenen "Deutschen Solarpreis". Zu den lobenswerten Projekten gehört in Heidelberg die Einführung eines eigenen "Heidelberger Standards" zum Klimaschutz. Weiter: die Einrichtung von verschiedenen Akteursgruppen und Gesprächskreisen. Des weiteren wurde seit Anfang der 90er Jahre ein kommunales Energiemanagement eingeführt, in dessen Rahmen der Energieverbrauch kommunaler Liegenschaften um 40 Prozent reduziert werden konnte. Der Gesamtstrombedarf muß zu mindestens 25 Prozent mit Ökostrom gedeckt werden. Der Aufpreis für den Ökostrom wird von den Stadtwerken Heidelberg sowie dem Stromanbieter wiederum in erneuerbare Energien investiert. Auch an die Verbreitung des Wissens über die erneuerbaren Energien wurde gedacht, indem zum einen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Handwerker und Architekten organisiert wurden, zum anderen durch sogenannte E-Teams an Schulen, mit denen die Jugend an die Themen Energie und Umwelt herangeführt wurde.
Auch von Kassel könnte Freiburg einiges lernen: Seit 1991 werden im Landkreis Kassel erneuerbare Energien konsequent ausgebaut. Heute existiert ein leistungsstarkes Netzwerk zwischen allen umweltrelevanten Institutionen des Kreises, das den regionalen Handlungsrahmen für die Mobilisierung der primären Wirtschaft immer weiter ausdehnt, um mit solaren Ressourcen die fossilen Energien abzulösen. Dieses Netzwerk kommt der Biogaserzeugung in der Landwirtschaft zugute, womit der Landkreis sein Ziel verfolgt, Land- und Forstwirte zu Energiewirten zu machen. Der Kreis betreibt zehn Biomasse-Anlagen in Schulen und anderen Einrichtungen. Es bestehen acht Wind-Parks und mit 13 beteiligten Kreis-Kommunen ist der Landkreis der größte Partner der deutschen Solarstrom-Kampagne 'Solar-Lokal'.
Vorbildlich ist auch die Gemeinde Morbach im Hunsrück. Die Gemeinde mit 11.000 EinwohnerInnen erzeugt so viel Strom aus erneuerbaren Ernergien, daß damit umgerechnet 13.000 Haushalte versorgt werden können. Allein die Pacht im Energiepark bringt der Gemeinde 280.000 Euro im Jahr. Soviel zum beliebten Argument, die Stadt Freiburg habe zu wenig Geld. Bauern aus der Umgebung von Morbach liefern Energiepflanzen für eine Biogasanlage. 4000 Quadratmeter Solarzellen glänzen in der Sonne, die schrägen Unterbauten dienen als Schafställe. 14 Windräder produzieren knapp 30 Megawatt Strom und mit der Abwärme der Biogasanlage werden Holzpellets getrocknet. Schulklassen, KommunalpolitikerInnen und Delegationen aus den USA, der Türkei, Chile oder Sri Lanka kommen nach Morbach, um von diesem Öko-Projekt zu lernen.
Ein entscheidender Punkt, warum es in Morbach funktioniert: Nicht der Energie-Konzern RWE betreibt - wie ursprünglich vorgesehen - den Energie-Park, sondern eine mittelständische Firma aus Mainz, die zudem an der neuen Biogasanlage beteiligt ist. Auch der Pellet-Pionier Uwe Schlüter hat seinen Sitz in Morbach. Bereits vor sieben Jahren machte er sich selbständig, um Pellet-Heizungen zu konstruieren. Mittlerweile hat er 600 Holzheizungen aufgebaut. Uwe Schlüter meint: "Die Leute wollen Holzheizungen nicht, weil sie ökologisch denken, sondern weil sie mich kennen und wissen, daß die Anlagen funktionieren."
Viele der genannten Entwicklungen hat Freiburg schlicht verschlafen, weil sich die Stadt auf den mittlerweile verwelkten Lorbeeren des Titels einer Ökohauptstadt ausgeruht hat. Daß die bundesweit bedeutende Messe 'Intersolar' dieses Jahr zum letzten Mal in Freiburg stattgefand, ist zwar symptomatisch, kann aber fairer Weise nicht Freiburg zur Last gelegt werden. Freiburg ist als Messestandort schlicht zu klein. Eher schon muß die Frage gestellt werden, ob es der Solar-Branche auf die Dauer bekommt, wenn immer mehr große Konzerne wie beispielsweise Shell sich auf diesem Terrain breit machen.
Auch beim wenig imposanten Ausbaustand der Windenergie auf Freiburger Gemarkung trifft die FreiburgerInnen wenig Schuld. Hauptverantwortliche für diese Misere waren der Vorgänger Günther Oettingers als baden-württembergischer Ministerpräsident Erwin Teufel und sein Statthalter im Freiburger Regierungspräsidium, Sven von Ungern-Sternberg.
Rheinland-Pfalz erzeugt wenigstens 1,2 Prozent Strom aus Wind, Baden-Württemberg liegt mit 0,1 Prozent bundesweit ganz hinten. Daß es auch anders geht, zeigt St. Peter - nicht weit von Freiburg entfernt: 2006 wurde gemeldet, daß St. Peter mit Windanlagen inzwischen mehr Strom produziert, als es verbraucht. Und das liegt nicht allein am für Windkraft besser geeigneten Standort.
Im Jahr 2006 wurden in Freiburg lediglich 1,6 Prozent des Gesamtstroms aus Bioenergie produziert. Noch vor der im Herbst 2006 aufgekommenen Klima-Debatte lautete Freiburgs bescheidenes Ziel, diesen Anteil bis 2010 auf 2,7 Prozent zu steigern. Eine Bremser-Funktion hat dabei - im Gegensatz zu anderen kommunalen Energiedienstleistern - die aus den Freiburger Energiewerken durch Fusion entstandene Badenova. Unverkennbar ist der Einfluß des Energie-Konzerns EnBW, neben RWE, E.on und Vattenfall eines der vier Oligopole, die den deutschen Strommarkt beherrschen und den Atomausstieg in Deutschland zu verhindern wußten.
Im Jahr der Reaktorkatatstrophe von Tschernobyl, 1986, wurde in Freiburg ein zukunftsträchtiges Energie-Konzept entwickelt. Das erklärte Ziel war, von der Atomenergie wegzukommen und die Energieressourcen zu schonen. Das Konzept stand auf drei Säulen, die Freiburgs Energiepolitik angeblich noch heute tragen: Sie heißen Energiesparen, effizienter Energieeinsatz und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen. 1996 verpflichtete sich die Stadt Freiburg, ihre Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahr 2010 um 25 Prozent zu senken.
1994 wurde als Ziel immerhin formuliert, daß bis zum Jahr 2010 zehn Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen sollen. Wie eben erwähnt schrumpfte dieses Ziel bis Mitte letzten Jahres bis auf 2,7 Prozent.
Auch im Hinblick auf Deponiegas erschöpfte sich die Freiburger Energiepolitik im Klein-klein: Bislang sind drei große und einige kleine Projekte verwirklicht worden, die Bioenergie in fester, flüssiger oder gasförmiger Form nutzen. Der Stadtteil Landwasser wird über ein Blockheizkraftwerk versorgt, das über Kraft-Wärmekopplung sowohl Strom wie auch Wärme produziert. Als Energieträger dient dazu auch das Methangas aus der stillgelegten Mülldeponie Eichelbuck. Erinnert sei an das in den 1990er-Jahren in Freiburg kläglich gescheiterte Projekt einer Anlage für mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, die als Alternative zur Müllverbrennung ins Spiel kam. Unter dubiosen Umständen brach der damalige Freiburger Umwelt-Bürgermeister Peter Heller das Projekt ab und bereits kurze Zeit später saß er auf dem gut dotierten Direktionssessel einer weitgehend unbekannten Umweltstiftung. Heute betreibt der benachbarte Landkreis Emmendingen das Projekt der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage erfolgreich auf der Mülldeponie Kahlenberg.
Als kleiner Freiburger Erfolg sei das Holzheizkraftwerk im ökologisch vorbildlich angelegten Stadtteil Vauban erwähnt. Auch dieses konnte nur gegen immense Widerstände nicht zuletzt aus dem Freiburger Rathaus von den engagierten BewohnerInnen des Stadtteils durchgesetzt werden.
Doch das Klimabündnis Freiburg, ein Zusammenschluß von engagierten BürgerInnen und Umweltverbänden, sieht nach wie vor große Potentiale ungenutzt. Im Dezember 2006 beschwerte sich das Klimabündnis öffentlich, daß "in Freiburg die Lösungen in den Schubladen" liegenblieben. Insbesondere wurde der pseudo-grüne Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon angemahnt, der im Aufsichtsrat der Badenova, des größten regionalen Energieanbieters, deren Geschäftspolitik positiv beeinflussen solle. Die durchweg guten Geschäftszahlen der Badenova beruhen laut Klimabündnis Freiburg überwiegend auf der massiven Verschwendung von Energie. Schritte, sich vom klassischen Energieanbieter zum Energiedienstleister zu wandeln, der den KonsumentInnen mit innovativen Stromtarifen hilft, den Verbrauch zu senken, seien kaum sichtbar. Auf dem Feld der Energieeinsparung sieht das Klimabündnis einen Milliardenmarkt mit enormem Potential für Arbeitsplätze.
So werden beispielsweise leider in der nahe Freiburg gelegenen Müllverbrenungsanlage TREA, wo auch der Freiburger Restmüll verbrannt wird, 50 Megawatt an Abwärme verschwendet. Eine Wärmemenge, die täglich 120.000 Liter Heizöl entspricht, wird nutzlos in die Umwelt geblasen.
Als beispielhaft verweist das Freiburger Klimabündnis auf die mehrfach preisgekrönte energetische Teilsanierung der Staudinger Gesamtschule in Stadtteil Haslach. Mit rund 250.000 Euro - wohlgemerkt aus der Bürgerschaft - wurde der Strom- und Heizenergieverbrauch um mehr als 25 Prozent gesenkt, jährlich 300 Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestoßen und dabei sechs Prozent Überschußverzinsung aufgebracht sowie der Schule 10.000 Euro pro Jahr gutgeschrieben. Doch ob dies im Freiburger Rathaus zur Kenntnis genommen wird, ist fraglich.
Wenig Wirkung erzeilte auch Josef Pesch, Geschäftsführer der fesa GmbH, mit seinem Fazit: "Freiburg deckt entgegen seinem Image nur ein Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien." ('Badische Zeitung' vom 29.07.03)
Anders als bei den erneuerbaren Energien bietet Freiburg im Bereich des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs, ÖPNV, immer noch ein relativ positives Bild. Dies beruht im Wesentlichen auf der bereits 1991 eingeführten "Regio-Umweltkarte", die später unter dem Namen Regiokarte bundesweite Beachtung fand. Freiburg schloß sich 1991 - nach erheblichem Druck aus der Umweltbewegung - mit zwei benachbarten Landkreisen zusammen und bot die Monatskarte zur Nutzung von Straßenbahn, Bus, und Bahn im gesamten Gebiet - der Regio - für 49 Mark an. Die Resonanz war enorm und der motorisierte Individualverkehr konnte merklich zurückgedrängt werden. Inzwischen wurde der Preis der Regiokarte zwar auf 44 Euro nahezu verdoppelt; doch anderswo ist dafür bestenfalls eine Karte fürs Stadtgebiet - oft aber noch nicht einmal für eine einzige Zone erhältlich.
Das Meinungsforschungs-Institut EMNID führte 2002 eine Studie mit Deutschlands ÖPNV-Verbünden über die Kundenzufriedenheit im öffentlichen Personen-Nahverkehr durch. Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) wurde in der Kategorie "Globalzufriedenheit der Fahrgäste mit den Verbünden" auf Platz 1 gewählt. Bei einem ÖPNV-Umwelt-Ranking des VCD aus dem gleichen Jahr (2002) war Freiburg nur in einem Segment Sieger, während Verkehrsbetriebe anderer Städte wie Saarlouis, Gera, Hannover oder Frankfurt/Oder in einzelnen Wertungs-Kriterien bereits deutlich besser abschnitten.
Vier Stadtbahnlinien verkehren tagsüber im 7½-Minutentakt und damit häufiger als Stadtbahn- und U-Bahnlinien in vielen erheblich größeren Städten wie Stuttgart, München oder Berlin. In Augsburg fahren sie
allerdings alle 5 Minuten.
Auch Karlsruhe hat Freiburg in mancher Hinsicht inzwischen überflügelt: Karlsruhe gilt heute als Mekka des Schienenpersonennahverkehrs. Die Stadtbahnzüge der Albtalbahn fahren vom Karlsruher Marktplatz aus bis weit ins Umland und wechseln dabei von den Straßenbahnschienen auf Eisenbahnstrecken. Die Verbindungen reichen beispielsweise über Heilbronn bis Öhringen, über Pforzheim bis Bietigheim und über Baden-Baden bis Achern. In Freiburg konnten in den 1990er Jahren nur kleinere umweltpolitische Erfolge wie die Breisgau-Bahn in die nahegelegene Nachbarstadt am Rhein und die Elztal-Bahn, sowie verschiedene ergänzende Straßenbahn-Linien in der Stadt erzielt werden.
Der letzte größere verkehrspolitische Erfolg, der hauptsächlich dem Freiburger VCD zu verdanken ist, kam 1999 mit der Einweihung des "Mobile", der mit der Fahrradstation kombinierten Mobilitätszentrale beim Hauptbahnhof. Dieses Modellprojekt mußte gegen den anhaltenden Widerstand des früheren SPD-Oberbürgermeisters Böhme erkämpft werden.
Der anfangs erreichte Effekt, den motorisierten Individualverkehr (MIV) ein Stück weit zurückzudrängen, wurde in Freiburg jedoch im Laufe der Jahre mehr und mehr aus den Augen verloren. Daß abgesehen von Hauptverkehrsstraßen und Gewerbegebieten überall Tempo-30-Zonen ausgewiesen wurden, ist auch in Freiburg lange her und inzwischen bundesweit Standard. Auch verkehrsberuhigte Bereiche, in denen Schrittempo gilt und die Kinder auf der Straße spielen dürfen, sind durchaus üblich und heben Freiburg nicht aus dem bundesrepublikanischen Durchschnitt heraus.
Weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat das Verkehrskonzept im Stadtteil Vauban. Doch diese ökologische Politik mußten die BewohnerInnen gegen heftigen Widerstand der Stadtverwaltung und mehrerer Ratsfraktionen erkämpfen und dabei zahlreiche Abstriche machen.
Zukunftsweisend in der ökologischen Verkehrspolitik sind sogenannte Buskaps, die dafür sorgen, daß die Autos hinter haltenden Bussen warten müssen. In Münster und in Zürich werden mittels Diagonalsperren auf Kreuzungen Schleichwegfahrten verhindert, da die Autos nur in eine Richtung abbiegen und nicht geradeaus fahren können. RadfahrerInnen haben hingegen freie Bahn. So kann die innerörtliche Belastung durch Ozon und Feinstaub reduziert werden.
Positiv zu erwähnen ist die außergewöhnlich große Fußgängerzone in der Freiburger Altstadt. Ein Problem ist jedoch das dortige Verbot für den Fahrradverkehr, da es weitgehend ignoriert wird. Zugleich birgt das Miteinander von Straßenbahn- und Radverkehr erhebliche Gefahren.
Das weitere Zurückdrängen des motorisierten Individualverkehrs ist umweltpolitisch in Freiburg offenbar kein Thema mehr. Dem Autoverkehr wird im Gegenteil in den letzten Jahren zunehmend mehr Verkehrsraum zur Verfügung gestellt. Die Priorität der städtischen Verkehrsplanung liegt beim Bau und Ausbau vierspuriger Straßen. So fordert die Stadt von Bund und Land nicht etwa den zweigleisigen Ausbau der Höllentalbahn, der Bahnverbindung in den Schwarzwald, sondern den Bau des Stadttunnels für den Autoverkehr in dieselbe Richtung. Immerhin konnte durch politischen Druck aus der Bevölkerung und von Seiten des VCD eine Takt-Verdichtung bei der Höllentalbahn statt der geplanten Stillegung erreicht werden.
Auch in anderer Hinsicht hat Freiburg die Anbindung an die Schiene - trotz Hauptbahnhof - umweltpolitisch aus den Augen verloren. Zwei Negativ-Beispiele: Als der städtische Bauhof noch in der Tullastraße war, hatte er seinen eigenen Industriegleis-Anschluß. Nach dem Umzug nach St. Gabriel hat er keinen mehr. Dabei wäre dort ein Gleis-Anschluß ohne großen Aufwand möglich gewesen. Die Stadt Freiburg hätte mit gutem Beispiel voran gehen müssen. Und auch IKEA hatte vor dem Umzug auf die "grüne Wiese" einen Gleis-Anschluß - nun wird alles über große LKWs angeliefert. Auch hierbei hat die Stadtverwaltung versagt. Leider ist der VCD mit seinen Vorschlägen zu einem "Runden Tisch Industriegleise" zusammen mit Industrie- und Handelskammer und Verbänden bei der Freiburger Stadtverwaltung ohne Erfolg geblieben.
Die positiven Effekte durch die Verbesserung der ÖPNV in der Innenstadt wurden zugleich durch den seit den 1970er Jahren umkämpften Ausbau der B31 zunichte gemacht. Wie frühzeitig vom VCD Freiburg vorausgesagt, brachte dieser Ausbau eine enorme Steigerung des Straßenverkehrs.
Die Situation des Freiburger Radverkehrs ist ebenfalls kaum vorbildlich zu nennen. Zwar beträgt der Anteil des Radverkehrs am innerörtlichen Verkehrsaufkommen laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) 26 Prozent. Doch dies ist eher dem überdurchschnittlich entwickelten ökologischen Bewußtsein der FreiburgerInnen als einer umweltpolitischen Förderung zu verdanken.
In Freiburg gibt es derzeit rund 160 Kilometer Radwege und Radfahrstreifen. Die meisten Hauptverkehrsstraßen haben Radfahrstreifen, Schutzstreifen oder Bordsteinradwege. Ältere Radwege sind teils auch dann als benutzungspflichtig ausgeschildert, wenn sie die Mindestbreite von eineinhalb Metern deutlich unterschreiten. Etliche Radwege sind noch immer so angelegt, daß sie den Radverkehr nur unnötig behindern und gefährden. Nach Ansicht von Fachleuten ist der Ausbaustand der Freiburger Radwege durchweg unbefriedigend.
Beim Umbau von Kreuzungen ist deutlich erkennbar, daß der Radverkehr in den Augen der PlanerInnen nur eine Randerscheinung ist und das Hauptaugenmerk nach wie vor dem Autoverkehr gilt. Ähnlich sieht es mit den Prioritäten aus, die der Gemeinderat setzt: im Doppelhaushalt 2005/2006 wurde die Radverkehrspauschale auf lächerliche 100.000 Euro jährlich halbiert. In einer Selbstdarstellung der Stadt heißt es dagegen: "Der Anteil des Radverkehrs hat in Freiburg zwar ein hohes Niveau erreicht, stagniert allerdings in den letzten Jahren. Um ihn weiter zu steigern, ist eine deutlich stärkere Förderung als in den letzten Jahren nötig." In der Realität steht statt dessen der vierspurige Bau und Ausbau von Straßen im Vordergrund.
In dieses Bild paßt, daß es in der Innenstadt zwar rund 6000 Fahrradabstellplätze, aber 9000 Autoabstellplätze gibt. Nach Einschätzung des ADFC wären etwa 5000 weitere Fahrradabstellplätze erforderlich. Doch im Freiburger Rathaus scheint auch dies auf taube Ohren zu stößen. Dem enormen Druck des Radverkehrs wird zwar hier und da ein klein wenig nachgegeben, doch von Radverkehrsförderung kann keine Rede sein.
In Städten wie Münster in Westfalen, Troisdorf bei Bonn oder Bozen in Südtirol werden Millionenbeträge in die Radfahr-Fördeung investiert und schlüssige Konzepte werden erarbeitet, um den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen - oder, wie Fachleute sagen, am Modal Split - zu steigern. Doch Geld allein ist nicht alles, denn gute Radverkehrsanlagen können teilweise sehr günstig sein und helfen bei der Einsparung vermeidbarer Ausgaben für den Autoverkehr. Beispielsweise kostet die Markierung eines Radfahrstreifens weniger als der Bau eines Bordsteinradwegs.
Zuletzt 2005 schrieben der ADFC und der Umweltverband BUND zusammen den "Fahrradklimatest" aus. Fahrradfreundlichste Großstadt ist Münster. Mit einer Durchschnittsnote von 2,05 ist die Stadt auch knapper Gesamtsieger. In der Gruppe bis 200.000 Einwohner geht der erste Preis an Erlangen, und bei den Städten bis 100.000 Einwohner siegt Bocholt. Auf dem Siegertreppchen stehen damit Kandidaten, die bereits 2003 oben waren.
Der Fahrradklimatest ist Teil des vom Umweltbundesamt geförderten Projektes "Umweltentlastung durch mehr Radverkehr", das die Kommunen bei der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans vor Ort unterstützen soll..
Von den rund 1,3 Millionen Fahrten täglich werden in Münster je nach Quelle etwa 35 bis 40 Prozent mit dem Fahrrad zurückgelegt, dies ist eine um drei- bis viermal höhere Quote als in vergleichbaren Städten. Das Radwegenetz innerhalb der Stadt erstreckt sich dabei auf einer gesamten Länge von 254 Kilometer (Stand: Ende 2005). Den RadfahrerInnen standen zum Ende des Jahres 2004 rund 12.000 Stellplätze für ihre Räder zur Verfügung, darunter 3.300 Plätze in einem Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof.
Vor dem beschriebenen Hintergrund der städtischen Energie- und Verkehrspolitik darf es nicht verwundern, wenn im Bereich Kleinklima, Ozon, Smog, Feinstaub in den letzten Jahren keine Fortschritte erzielt werden konnten. So blieb beispielsweise die bodennahe Ozonbelastung in Freiburg im Zeitraum von 1995 bis 2006 in einer Bandbreite zwischen durchschnittlichen Jahreswerten von 46 und 54 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft nahezu unverändert. Im Juli 2006 erreichte die Ozonbelastung in Freiburg mit 239 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft einen beschämenden Spitzenwert in Deutschland. Fahrverbote, die noch zu Zeiten diskutiert wurden, als die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel als Kohls Umweltministerin firmierte, sind heute undenkbar. Freiburgs Oberbürgermeister Salomon würde allenfalls unter starkem politischen Druck zu einer solchen Maßnahme zu bewegen sein.
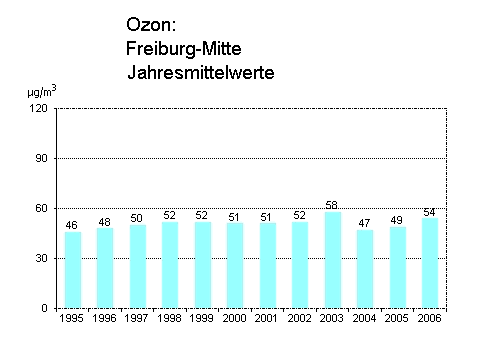
In einer Darstellung der Stadt Freiburg zum Flächennutzungsplan 2020 ist zu lesen: "Heute steht weniger die Anlage von neuen Parks im Vordergrund als viel mehr die Befriedigung vielfältiger, verstärkt wegeorientierter Ansprüche an Freiräume, die innerhalb und mit der bebauten Stadt vernetzt werden müssen. Nur so können sie auch weiterhin ihre wichtigen ökologischen Funktionen erfüllen, z.B. die Durchlüftung der Stadt Freiburg auch unter den geänderten Vorzeichen des Klimawandels aufrechtzuerhalten." Statt dessen wurde beispielsweise mit dem Prestigeobjekt des neuen Hauptbahnhofs strömungstechnisch ein Riegel aufgebaut, der den "Höllentäler"-Wind, der in Freiburg nicht nur für Migräne, sondern auch für Frischluftzufuhr sorgt, auf seinem Weg in Richtung des Stadtteils Stühlinger verwirbelt und ablenkt. Dieser Effekt war von Bürgerinitiativen bereits vor dem Bau des hochgeschossigen Gebäudes vorhergesagt und kritisiert worden. Immerhin hatte die Kritik eine geringfügige Abänderung der Planung und eine kleine Lücke in der Gebäudefront bewirken können.
Auch im Hinblick auf die seit Jahren heftig diskutierte Feinstaub-Problematik bleibt die Freiburger Stadtverwaltung jeglichen Schutz der Bevölkerung schuldig. Lediglich eine hilflose Umwelt-Aktion war im August 2005 zu beobachten: Der Co-Chef der Freiburger Verkehrs AG Rolf-Michael Kretschmer zeichnete Fahrgäste beim Aussteigen aus Bus und Stadtbahn mit einem T-Shirt als "Umwelthelden" aus. Wir konnten leider nicht in Erfahrung bringen, ob der Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon ebenfalls ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Umweltheld" bekam.
Nach wie vor sterben pro Jahr 60.000 Menschen in Deutschland vorzeitig wegen Feinstaubbelastung. Im Oktober 2006 wurde selbst der gesetzliche Höchstwert für Feinstaub in Freiburg überschritten, ohne daß dies irgendwelche Konsequenzen nach sich gezogen hätte.
Während in den bisher beschriebenen Bereichen teilweise gebremste Fortschritte oder Stagnation zu verzeichnen ist, muß bei der ökologischen Stadtentwicklung in Freiburg sogar eine negative Tendenz festgestellt werden. Während andernorts der Trend der familienfreundlichen Stadtentwicklung verstärkt in Richtung eines dichteren, mehrgeschossigen Wohnungsbaus geht, vollzieht Oberbürgermeister Salomon eine Kehrtwende: In Freiburger Wohngebieten soll künftig eine Geschoßflächenzahl von 1,2 nicht mehr überschritten werden. Die Geschoßflächenzahl ist ein Maß, wieviel Wohnraum pro bebauter Fläche geschaffen wird. Beim Freiburger Stadtteil Rieselfeld mit einer Gesamtfläche von 78 Hektar konnte mit einer Bebauung mit drei bis fünf Geschossen eine durchschnittliche Geschoßflächenzahl von 1,2 erreicht werden.
Es ist übrigens ein Trugschluß, daß mit Hochhausbauten eine höhere Geschoßflächenzahl erzielt werden könne. Dies ist in Deutschland wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände nicht möglich. Eine weit überdurchschnittliche Geschoßflächenzahl von 1,6 bietet in Freiburg beispielsweise der von Wohnhäusern aus der Gründerzeit geprägte Stadtteil Ober-Wiehre. Trotz enger Bebauung und hoher Einwohnerdichte ist dieser Stadtteil, der von Straßen mit altem Baumbestand und kleinen Parks geprägt ist, sehr beliebt. Nicht zufällig ist die Ober-Wiehre unter Wohnungssuchenden in Freiburg äußerst begehrt - und zeichnet sich folge dessen leider auch durch ein hohes Mietniveau aus. Längst ist unter StädteplanerInnen bekannt, daß mit einer dichteren, mehrgeschossigen Bebauung nicht nur eine höhere Einwohnerdichte und eine bessere soziale Durchmischung, sondern zudem ein besseres Wohnklima geschaffen werden kann als mit den nach wie vor häufig nach Schema F gebauten Neubausiedlungen mit Einfamilienhäuschen.
Leider wurde in den letzten Jahren bei den Projekten am Sandfangweg und in der Steinhalde in Ebnet die ursprüngliche Planung heruntergefahren und beim Projekt Coats Mez in der Kartäuserstraße wurde eine "lockere Bebauung" bevorzugt. So ist auch der Flächenverbrauch durch Neubaugebiete und Gewerbeansiedlungen auf der Freiburger Gemarkung entgegen früherer Versprechungen bislang nicht gestoppt worden. Die Zersiedelung der Landschaft um Freiburg hat unerträgliche Ausmaße angenommen und der örtliche Regionalverband der Umwelt-Organisation BUND regte sarkastisch an, Freiburg im Breisgau angesichts eines die Landschaft überziehenden Siedlungsbreis in "Breiburg im Breisgau" umzubenennen.
Obwohl die FreiburgerInnen nach wie vor überdurchschnittlich bei der Mülltrennung engagiert sind, wurde Freiburg auch auf dem Feld der ökologischen Abfallpolitik inzwischen von Ulm überflügelt. Während in Baden-Württemberg im Durchschnitt pro Kopf und Jahr 147 Kilogramm Restmüll anfallen, sind dies in Freiburg 132 Kilogramm und in Ulm 126 Kilogramm. Als Vorbild können sich allerdings beide Städte beispielsweise an Raststatt mit 97 Kilogramm oder an Calw orientieren, das mit nur 76 Kilogramm fast nur halb soviel Restmüll produziert wie der baden-württembergische Durchschnitt. An der Spitze in Baden-Württemberg liegt der Landkreis Freudenstadt mit nur 66 Kilogramm, also mit gerade der Hälfte der Menge an Restmüll, die in Freiburg pro Kopf und Jahr anfällt.
Während Bürgerinitiativen bereits vor 15 Jahren gezeigt haben, daß mit einem einfachen Wertmarken-System das Müllaufkommen drastisch reduziert werden kann, scheinen solche einfachen Erkenntnisse bis heute nicht bis in die höheren Etagen der Stadtverwaltungen vorgedrungen zu sein. Auch die baden-württembergische Umweltministerin Tanja Gönner redet lediglich davon: "Wir brauchen ein Umdenken. Abfälle sind wertvolle Ressourcen und sollten auch entsprechend genutzt werden." Konsequenzen sind jedoch weder auf Landes- noch auf kommunaler Ebene erkennbar.
In Freiburg existiert zwar seit Jahren eine Baumschutzsatzung. Es ist jedoch nicht erkennbar, daß diese zu einer Vermehrung des seit Jahren gleichbleibend mit rund 22.000 Straßenbäumen und rund 25.000 Parkbäumen aufgeführten Baumbestands geführt hätte. Viele UmweltschützerInnen in Freiburg erinnern sich noch heute an die Kettensäge-Aktion im Konrad-Guenther-Park, bei der ein wunderbarer alter Baumbestand dem Ausbau der B 31 geopfert wurde. Karlsruhe beispielsweise verzeichnet mit rund 157.000 Straßen- und Parkbäumen einen mehr als dreimal so hohen Baumbestand als Freiburg.
Die Stadtverwaltung Freiburgs behauptet zwar pauschal (auf der web site http://www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1174584_l1/index.html) eine "deutlichen Zunahme der Artenvielfalt bei Fauna und Flora", kann hierfür aber keinen Beleg bieten.
Der in den Wäldern um Freiburg noch vor 30 Jahren häufig anzutreffende Laubfrosch ist heute kaum noch zu finden. Auch der Bestand der Wechselkröte ist auf der Gemarkung Freiburg innerhalb der letzten 10 Jahre deutlich zurückgegangen. Auch der Springfrosch ist seltener geworden.
Wenn beispielsweise Reste von Feuchtgebieten erhalten werden konnten - wie etwa das im Einzugsbereich Freiburgs bei Waltershofen gelegene NABU-Schutzgebiet Humbrühl, dann ohne die Hilfe und oft gegen den Widerstand von Bürokratie und Verwaltung, indem Flächen mit Hilfe von Spenden aus der Freiburger Bevölkerung aufgekauft wurden. Sonst wäre beispielsweise das Sumpf-Heusenkraut auf Freiburger Gemarkung heute sicherlich nicht mehr zu finden.
An Schmetterlingen ein Beispiel: der Weiße Waldportier. In Baden-Württemberg war früher die gesamte Oberrheinebene bis zum Odenwald besiedelt, diese Areal ist nun auf den Kaiserstuhl und das angrenzende Hügelland zusammengeschmolzen. Der Weiße Waldportier ist auf der Roten Liste als "stark gefährdet" verzeichnet.
Die bereits erwähnte baden-württembergische Umwelt-Ministerin Tanja-Gönner erwähnte in ihrem aktuellen Abfall-Bericht durchaus zu recht, daß Abfälle nach wie vor wertvolle Ressourcen enthalten. Beim Altpapier hat der Preis von 50 Euro pro Tonne im Jahr 2006 auf aktuell 70 bis 80 Euro pro Tonne angezogen. Es handelt sich also nicht mehr ausschließlich um ökologisch wertvolle, sondern auch um zunehmend im wirtschaftlichen Sinne wertvolle Ressourcen. Dennoch ist das Beschaffungswesen der Stadt Freiburg noch wenig ökologisch ausgerichtet. So mußte Freiburgs Umwelt-Bürgermeisterin Gerda Stuchlig Anfang 2006 einräumen, daß erst ab diesem Zeitpunkt FSC-zertifiziertes Frischfaserpapier für die Verwaltung und die städtischen Schulen beschafft wird - immerhin ein kleiner ökologischer Fortschritt. Doch bei einem Verbrauch von jährlich insgesamt 16,3 Millionen Blatt Papier wird nach wie vor lediglich ein Anteil von 63 Prozent in Recycling-Qualität verwendet.
Wenn wir nun also eine Bilanz über das gesamte Spektrum kommunalpolitischer Umweltpolitik ziehen -
Erneuerbare Energien (Solar - Wind - Wasser - Biogas)
BHKW (Blockheizkraftwerke)
Wärmedämmung, Energieeffizienz
ÖPNV (öffentlicher Personen-Nahverkehr)
Zurückdrängen von motorisierten Individualverkehrs (MIV)
Radverkehr / Radwegenetz
Stadtplanung
Wohnraumverdichtung
Flächenverbrauch
Müllaufkommen / Recycling
Kleinklima / Ozon / Smog / Feinstaub
Baumbestand / öffentliche Grünfläche /
Effektivität der Baumschutzsatzung
Artenvielfalt
ökologische Bildung
städtisches Beschaffungswesen -
ergibt sich ein ernüchterndes Bild, das so gar nicht zum Nimbus Freiburgs als Deutschlands Ökohauptstadt passen will. Dabei müßten an eine Stadt, die wirklich realistisch die Herausforderungen der herannahenden Klimakatastrophe und fortschreitenden Umweltzerstörung annehmen wollte, weit strengere Maßstäbe angelegt werden, als wir es hier taten. Eine wirkliche Ökohauptstadt müßte nicht allein die Umweltzerstörung relativ zu anderen Städten stärker bremsen - es müßte eine Wende um 180 Grad stattfinden, eine Entwicklung in die positive Richtung, statt eine gebremstes weiteres Abgleiten in die negative Richtung.
Freiburg hat sich schon viel zu lange auf dem einmal verdienten Vorschußlorbeer ausgeruht. Vorschußlorbeer, weil es sich ja nur um Ansätze zu einer realen Wende gehandelt hatte. So konstatiert auch der örtliche Regionalverband der Umwelt-Organisation BUND: "Doch bedeutet "Umwelthauptstadt" eigentlich nicht mehr, als daß die weltweiten Zerstörungsprozesse in Freiburg ein wenig langsamer ablaufen als anderswo." Daß sich die FreiburgerInnen allzu lange wie Öko-Weltmeister fühlten, mag zum einen daran liegen, daß ihnen mit dem längst imaginären Titel "Ökohauptstadt" von den Mainstream-Medien Honig um den Bart geschmiert wurde - und daß offensichtlich immer noch eine Mehrheit davon überzeugt ist, mit dem pseudo-grünen Oberbürgermeister Dieter Salomon säße ein Anwalt der Umwelt auf dem Chefsessel im Freiburger Rathaus.
REGENBOGEN NACHRICHTEN