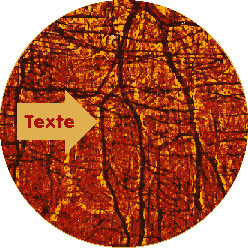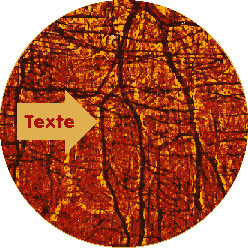Bereits im vergangenen Jahr hat die EU-Kommission eindringliche Warnungen an die damals noch konservative Regierung in Spanien gesandt. In der Öffentlichkeit wurde dies kaum wahrgenommen, da Spanien in den Massenmedien permanent als Musterbeispiel eines nach neoliberaler Wirtschaftstheorie gelenkten prosperierenden Staatswesens dargestellt wurde. Doch die spanische Immobilien-Blase könnte einen Crash auslösen, der zum Zusammenbruch der europäischen Wirtschaft führt.
Spanien hatte ein überdurchschnittlich hohes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Arbeitslosenrate zu verzeichnen. Weniger bekannt ist der eklatante Anstieg der Immobilienpreise in Spanien, der nicht zuletzt von einer von Deutschen und Niederländern angeheizten Nachfrage verursacht wurde. Im Durchschnitt der letzten Jahre stiegen die Preise für Immobilien um 17 Prozent pro Jahr. Da in Spanien Wohnraum traditionell eher gekauft als gemietet wird und die Immobilienkredite weit überwiegend mit variablen Zinsen abgeschlossen wurden, stieg auch die Verschuldung der privaten Haushalte in horrendem Maße. Nach Auskunft der Zentralbank stiegen in Spanien die privaten Schulden 2003 um 19 Prozent und haben mittlerweile einen Stand von über 500 Milliarden Euro erreicht. In den letzten fünf Jahren verdoppelten sich die Schulden der spanischen Familien nahezu.
Im jährlichen Herbstbericht 2003 hatte die EU-Kommission Spanien zudem vor den Folgen gewarnt, wenn die Immobilien-Blase, die seit 2001 Gesprächsthema unter Insidern ist, platzt. Beim Anstieg der Immobilienpreise in Spanien handelt es sich auch nach Ansicht der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) nicht um einen realen Wertzuwachs. In ihrem Frühjahrsbericht zur Entwicklung in Spanien sind außergewöhnlich drastische Formulierungen zu finden: So wird Spanien vor einem "brutalen und plötzlichen" Verfall der Immobilienpreise gewarnt. Banken in Spanien gehen unter der Hand davon aus, daß spanische Immobilien zwischen acht und 20 Prozent überbewertet seien. Seit 1997
haben sich die Preise der Wohnungen verdoppelt. Damit steigt die Gefahr eines Crash am Immobilien-Markt.
Die Mieten sind in Spanien extrem teuer, während Immobiliendarlehen recht günstig sind. Das verführt dazu, eher eine überteuerte Wohnung zu kaufen. Hinzu kommen Spekulation und die allgemeine Bereitschaft, Geld bevorzugt in Immobilien statt in Aktien anzulegen. Die spanische Statistikbehörde INE hat festgestellt, daß sich im Juli 2003 die Verschuldung der Haushalte in Folge des Kaufs einer Immobilie im Vergleich zu Juli 2002 um 23 Prozent erhöht hat. Außerdem wird in Spanien weniger gespart - nur noch rund 13 Prozent des Einkommens (1995: 16 Prozent). Die EU-Kommission sieht die Gefahr, daß ein Ansteigen der Zinsen und eine Verschlechterung der Situation am Arbeitsmarkt den Crash auslösen könnte, der viele Haushalte wirtschaftlich in den Ruin treiben wird.
Beim Platzen der Aktien-Blase am "Neuen Markt" der IT-Technologie im Frühjahr 2000 wurden an den globalen Aktienmärkten rund 16 Billionen Dollar vernichtet. Die Zentralbanken, vorne weg die US-amerikanische Federal Reserve, "Fed", reagierten darauf mit einer beispiellosen Absenkung ihrer Leitzinsen. Zum einen wurden auf diese Weise die Geschäftsbanken mit riesigen Mengen an preiswerter Liquidität überschwemmt. Dabei wurden neue Finanzwerte-Blasen geschaffen, die zumindest auf dem Papier den Bankrott des Gesamtsystems verschleierten. Zum anderen trugen die niedrigen Zinsen dazu bei, Millionen private Haushalte in den USA und anderswo in eine immer höhere Verschuldung durch Konsum und Hauskauf zu locken. Aber aktuell zeigt sich, daß die Zentralbanken ihre Leitzinsen nicht mehr länger künstlich niedrig halten können. Und sobald die Zinsen steigen, wird die Immobilien-Blase platzen und ein Platzen der Finanzwerte-Blasen nach sich ziehen. Die gesamte europäische Wirtschaft wird eine Krise erleben, die sich nur mit dem Börsen-Crash vom "Schwarzen Freitag, dem 25. Oktober 1929, und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise vergleichen läßt.
Auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnte bereits in ihrem Quartalsbericht Anfang März unmißverständlich vor der bedrohlichen Lage auf dem spanischen Häuser- und Hypothekenmarkt. Am 13. März präsentierte der Londoner 'Economist' seine neueste Studie zu diesem Thema. Das Ergebnis: "Die Immobilienpreise befinden sich im Verhältnis zu den Durchschnittseinkommen auf Rekord-Niveau in den USA, Australien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und in Spanien. Die Preise britischer, irischer und holländischer Immobilien liegen nun - im Verhältnis zum Jahreseinkommen - 50 Prozent über ihrem 30-jährigen Mittel." Nach dem gleichen Maßstab seien die Häuser in den USA um 23 Prozent, in Australien um 33 Prozent und in Spanien gar um 68 Prozent überbewertet. Basierend auf der Economist-Studie sprach der 'Edinburgher Scotsman' daraufhin von der kommenden "Globalen Kernschmelze" auf den Immobilienmärkten. Immerhin handelt es sich hier um einen Anlagewert von rund 50 Billionen Dollar, fast doppelt so viel wie der Wert aller weltweit umlaufenden Aktien.
Anders als in den USA, Australien, Deutschland, Großbritannien, Irland oder Frankreich, wird der aktuelle Zinsanstieg in Spanien zu großen Problemen bei den privaten Haushalten führen. Zu über 90 Prozent wurden die Kredite in Spanien mit variablen Zinsen abgeschlossen. Noch hat Europäische Zentralbank bei ihrem Treffen in Frankfurt, Main, einen Tag nach der Zinserhöhung durch die "Fed" dementiert, ebenfalls die Zinsen zu erhöhen. Dennoch müssen bereits jetzt rund drei Millionen Haushalte in Spanien mehr an Zinsbelastung verkraften. Die variablen Zinsen sind in Spanien nicht an den Leitzins, sondern an den sogenannten Euribor gebunden. Dabei handelt es sich um einen Zinssatz, den die europäischen Banken beim Handel von Einlagen mit festgelegter Laufzeit vereinbaren. Und der Euribor ist bereits in den letzten drei Monaten gestiegen.
Damit ist für viele spanische Familien eine optimistische Spekulation auf anhaltend niedrige Kredit-Zinsen geplatzt. Die Hypotheken-Zinsen liegen zwar mit 3,75 Prozent noch unter dem EU-Durchschnitt (4,55 Prozent in der EU der 15), doch selbst ein geringer Anstieg der Kredit-Last um zehn oder zwanzig Euro monatlich kann für viele Familien schnell das finanzielle Aus bedeuten. Laut der spanischen Statistikbehörde INE haben über 50 Prozent der spanischen Haushalte bereits heute akute Finanzprobleme. Dies zeigt sich auch in der geringen Spar-Rate. Stärker noch als in Deutschland wächst die Zahl der privaten Insolvenzen.1 Verschärft wird die Situation in Spanien durch einen Anstieg der Inflation. Von Mai auf Juni war in Spanien ein Preisanstieg von 3,5 Prozent zu verzeichnen. Und zugleich brechen für Spanien in Folge der Ost-Erweiterung der EU Milliarden-Subventionen weg.
Die Situation in Spanien ist mit der Japans im Jahre 1991 vergleichbar. Als dort die Immobilien-Blase platzte, flogen faule Kredite in Milliardenhöhe auf. Die japanischen Banken konnten nur durch massive staatliche Stützungen vor dem Ruin gerettet werden. Das im Vergleich zu Spanien um ein Vielfaches finanzstärkere Japan hat sich bis heute noch nicht völlig von der damaligen Wirtschaftskrise und der dadurch ausgelösten Massenarbeitslosigkeit erholt. Die Arbeitslosen-Quote stieg auf 5,5 Prozent - in Spanien liegt sie heute bereits doppelt so hoch.
Die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren war ebenfalls durch das Platzen einer spekulativen Blase ausgelöst worden. Aufgrund enormer Steigerungen der Aktienkurse in den "Goldenen Zwanzigern" hatten sich insbesondere in den USA weite Teile der Bevölkerung bis hinein in die untere Mittelschicht zum Kauf von Aktien verleiten lassen. Die durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerungen von Industrie-Aktien beliefen sich Mitte der 20er Jahre auf 30 Prozent. Doch der Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index, der Aktienindex der 30 größten US-Unternehmen, hatte bereits kleinere Einbrüche erlebt. Am 8. Dezember 1928 waren die Kurse um 5,1 Prozent gesunken. Sie erholten sich aber rasch wieder und konnten die allgemeine Überzeugung, in einem "völlig neuen Zeitalter" zu leben, nicht brechen. Die Wirtschaft boomte geradezu seit 1924. Doch dann kam eine Überproduktions-Krise. In der Hochkonjunktur waren Überkapazitäten aufgebaut worden.
Die bürgerlichen Nationalökonomen erklärten hernach - mit WK II war "tabula rasa" gemacht worden - alles zu einer Verquickung unglücklicher Umstände. Im Kapitalismus sei immer wieder mit zyklischen Rezessionen zu rechnen, denen aber durch geschickte Politik entgegenzusteuern sei.
Bei einer Analyse sollten allerdings zunächst zwei Phänomene auseinander gehalten werden: Die Entwicklung der Börsen-Kurse und die Entwicklung im industriellen Sektor. Kursstürze an den Börsen hatten keinesweg immer eine Rezession zur Folge. So blieb beispielsweise der Kurssturz vom 19. Oktober 1987 mit 22,6 Prozent (weit mehr als 1929) ohne negative Auswirkung auf die Konjunktur.
Zur Erklärung der Kursschwankungen an der Börse gibt es in der bürgerlichen Nationalökonomie grob betrachtet zwei Theorien: Eine der beiden mißt dem Markt eine hohe Rationalität bei. Kursschwankungen werden als Zufallsschwankungen um einen realistischen Mittelkurs angesehen, der den realen Wert der Firmenbeteiligung widerspiegelt. Die andere Theorie unterstellt eine hohe Irrationalität der Anleger und erklärt langfristige Abweichungen des Kurses von den "Fundamentalwerten" durch letztlich nur psychologisch zu erklärende Kaufmanie. Letztlich erklärt das gar nichts, sondern ist ein bequemer Zirkelschluß. Bei einem konstanten Niveau der "Fundamentalwerte" erklärt die erste der beiden Theorien den Sachverhalt völlig plausibel. Kommt es jedoch während einer Konjunktur zu einem realen Wertzuwachs eines Unternehmens, steigt der Aktienkurs in Folge der zunehmenden Nachfrage überproportional. Das Anwachsen einer "Blase" ist nichts anderes als eine zunehmende Abweichung des Aktienkurses vom realen Wert des betreffenden Unternehmens.
Da sich der reale Wert eines Unternehmens jedoch schwer in Zahlen fassen läßt und im Kapitalismus immer ein großes Interesse besteht, die Differenz zwischen Aktienkurs und realem Wert zu leugnen, wird dieser Sachverhalt in der Regel verschleiert. So sollen beispielsweise die genannten "Fundamentalwerte" eine Möglichkeit darstellen, den realen Wert eines Unternehmens zu ermitteln. Der "Fundamentalwert" wird i.a. definiert als die mit dem langfristigen Marktzinssatz abdiskontierte Summe der erwarteten Dividenden einer Aktie. Nehmen die ausgeschütteten Unternehmensgewinne zu, so steigt der Fundamentalwert, ebenso bei sinkenden Zinssätzen. Diese Methode verwendet offiziell die US-Notenbank. Sie wählt hierzu den S&P500-Aktienindex als Basis (er erfaßt 500 amerikanische Unternehmen), legt die Gewinnschätzungen des nächsten Jahres zugrunde, dividiert sie durch die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen und multipliziert mit 100. Ende September 1999 ergab sich daraus ein Fundamentalwert von ca. 950. Die Schwierigkeit liegt aber in der Frage: Halten sich auch die Anleger an diese Regel? Offenbar nicht immer. Der tatsächliche Wert des S&P500-Index lag Ende September 1999 um 250 Punkte höher, bei über 1200 Punkten.
Beim Crash von 1987 blieben die Kleinanleger wider Erwarten ruhig, während professionelle Anleger der Verkaufsorder ihres Computerprogramms folgten. Auch die Erklärung der Kursbewegungen durch Zufallsschwankungen ist immer mehr in die Kritik geraten. Zwar wurden komplexe Modelle zur Erfassung von Zufallseinflüssen entwickelt und neue Anlageformen erdacht (Zukunftskontrakte, Optionsscheine, Hedge-Fonds usw.). Doch die praktische Anwendung dieser Modelle erfuhr eine jähe Ernüchterung, als ein großer US-amerikanischer Hedge-Fond (Long Term Capital Management, LTCM) durch die Anwendung solcher Modelle im September 1998 Milliardenverluste erleiden mußte. Ein Jahr zuvor waren die Erfinder dieses mathematischen Modells und Berater von LTCM (Robert Merton und Myron Scholes) noch mit dem Nobelpreis für Ökonomie gekürt worden.
Der Crash von 1929 erschütterte eine Weile den liberalen Glauben an das unaufhörliche Wirtschaftswachstum. John Maynard Keynes formulierte 1936 vor dem Hintergrund dieser Erfahrung eine neue Theorie, in der die Spekulation eine zentrale Rolle spielt. Seine Schlußfolgerung lautete: Der Kapitalismus neigt zu Unterbeschäftigung aufgrund der Wechselwirkung zwischen Geld-, Kapital- und Gütermarkt. Der Staat muß durch defizitfinanzierte Ausgaben Nachfrageeinbrüche ersetzen. (Bei sinkenden Löhnen und Aktienkursen sinkt auch der private Konsum.) Ein Haushaltsdefizit führt meist zu einer höheren Inflationsrate. Dies wiederum senkt den Anreiz für Spekulanten, Geld unproduktiv zu horten, und fördert so die Anlage in Sachkapital.
Der Siegeszug des Keynesianismus nach WK II endete allerdings in der Weltrezession der 70er Jahre, in der wider die Keynessche Prognose Inflation und Arbeitslosigkeit andauerten ("Stagflation"). Diese Erfahrung führte zur großen Wende in den Wirtschaftswissenschaften und ebnete dem Monetarismus den Weg. Milton Friedman, Schüler von Irving Fisher, trat der Keynesschen Vorstellung einer langfristigen Instabilität der Märkte entgegen. Der Siegeszug des Neo-Liberalismus begann. Er forderte einen Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und eine vorhersehbare, stabile Geldpolitik. Den Grund für den Crash von 1929 und die nachfolgende Weltwirtschaftskrise erklärte Friedman mit einer "falschen" Notenbankpolitik, nicht etwa mit einer strukturellen Instabilität des Kapitalismus.
Doch auch in den 20er jahren waren die Notenbanken in einer Zwickmühle. Seit 1925 hatten sich die wichtigsten Industrieländer auf den Goldstandard, also ein System fixer Wechselkurse geeinigt. (Ähnlich wird heute weltweit der Dollar als grundlegende Verrechnungseinheit akzeptiert und innerhalb Europas hat inzwischen der Euro diese Funktion übernommen.) Durch die Stabilisierung der Wechselkurse waren den Notenbanken im Inland die Hände gebunden. So erfolgte die Reaktion auf den Crash spät und förderte den
Zusammenbruch des Banksystems. Aber auch der Verzicht auf eine Stabilisierung der Wechselkurse konnte Währungszusammenbrüche wie in der Asienkrise nicht verhindern.
Zudem können der Notenbank auch aus anderen Gründen die Hände gebunden sein: Sind die Zinssätze bereits sehr niedrig und befindet sich Wirtschaft an der Schwelle zu einer Deflation, dann wird die Geldpolitik wirkungslos. Ein Zinssatz von nahe Null kann nicht mehr gesenkt werden. Keynes nannte das die "Liquiditätsfalle", das Kennzeichen der 30er Jahre.
Daß sich eine Wirtschaftskrise wie 1929 trotz aller institutionalisierten Sicherungsmaßnahmen wiederholen kann, hat die Asienkrise nach 1997 bewiesen. Bisher scheint der Kursanstieg an der Wall Street und in Europa kaum gebrochen. In den USA zog die Aktienbörse sogar den privaten Konsum mit - ein historisch neues Phänomen. Und als dieser seit 2001 ins Straucheln geriet, konnte die US-Regierung durch "Senkung der Rohstoffpreise" - sprich: Überfall auf Afghanistan und Besetzung der zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt ("Irak") - nochmals einen zeitlichen Aufschub erzwingen. Aber der Aktienboom der Clinton-Ära verdankt sich vor allem hohen Gewinnen durch langfristig gesunkene Reallöhne - nicht etwa realem Wirtschaftswachstum - und hat so eine immer tiefere Kluft zwischen Reich und Arm aufgerissen. Kostensenkungen durch Fusionen beflügelten den Markt; doch dieses Potential dürfte ausgereizt sein. Das Handelsbilanzdefizit, das Japans Konjunktur stützt, ist stetig gewachsen und machte die USA zum Nettoschuldner der übrigen Welt.
Bislang aber bleiben die Analysten optimistisch. "Die Aktienkurse haben ein dauerhaftes Niveau erreicht. Sie sind nicht zu hoch, und die Wall Street wird nichts dergleichen wie einen Crash erleben." Das schrieb am 5. September 1929 in der New York Times der bekannteste US-Ökonom der 20er Jahre: Irving Fisher.
Harry Weber
Anmerkung:
1 Siehe auch unseren Artikel
Profite, Pleiten und Sozialabbau (27.03.04)