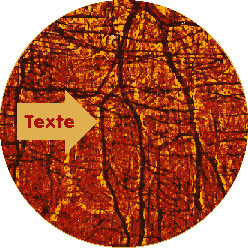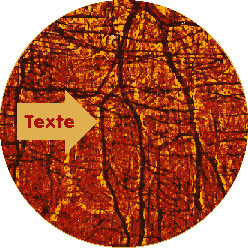Es ist nun schon viele Monate her, daß ich mich im Gewissen genötigt sah, mein Schweigen zu
beenden und öffentlich gegen den Krieg meines Landes in Vietnam Stellung zu beziehen. Die
Gründe, die mich zu dieser schweren Entscheidung führten, sind noch nicht verschwunden, im
Gegenteil, sie sind durch den Lauf der Ereignisse seit damals noch schwerwiegender geworden.
Der Krieg selbst hat sich intensiviert, der Druck auf mein Land ist noch mörderischer.
Ich kann nicht über die großen Themen der Gewalt und Gewaltlosigkeit, sozialen Änderungen und
Zukunfts- hoffnungen sprechen, ohne dabei an die ungeheuerliche Gewalttat von Vietnam zu
denken.
Seit dem Frühling 1967, als ich zum ersten Mal meine Opposition gegen die Politik meiner
Regierung in der Öffentlichkeit bekannt machte, haben schon viele die Klugheit meiner
Entscheidung in Zweifel gezogen. "Warum gerade Sie?" sagte man. "Friede und Bürgerrechte
gehen nicht Hand in Hand. Verletzen Sie nicht die Sache Ihres Volkes?" Und wenn ich solche
Fragen hörte, war ich immer tief traurig, denn sie bedeuten, daß die Fragenden mich, meine
Absicht oder meine Berufung nie wirklich gekannt haben. Ja, diese Frage weist sogar darauf hin,
daß sie die Welt nicht kennen, in der sie leben. Wenn ich meinen Standpunkt vertrat, versuchte
ich immer zu erklären, daß ich bestürzt bin - wie jeder, glaube ich, bestürzt sein muß -
über die Verworrenheiten und Unklarheiten der Vietnam-Frage. Ich möchte das Bedürfnis nach
einer gemeinsamen Lösung dieses tragischen Konflikts nicht unterschätzen. Ich möchte weder
Nordvietnam oder die Nationale Befreiungsfront als Muster an Tugend hinstellen, noch die Rolle
mißachten, die sie bei einer erfolgreichen Lösung des Problems spielen können. Während sie
beide berechtigte Gründe haben mögen, der Gutgläubigkeit der Vereinigten Staaten zu mißtrauen,
legen das Leben und die Weltgeschichte beredtes Zeugnis davon ab, daß Konflikte nie ohne
vertrauensvolles Geben und Nehmen von beiden Seiten gelöst werden.
Da ich Prediger aus Berufung bin, dürfte es wohl nicht überraschen, daß ich verschiedene Gründe
habe, Vietnam in mein moralisches Blickfeld zu ziehen. Da ist vorerst eine sehr augenfällige, ja
fast mühelose Verbindung zwischen dem Krieg in Vietnam und dem Kampf, den ich und andere in
Amerika geführt haben. Vor einigen Jahren gab es in diesem Kampf einen strahlenden Augenblick.
Es schien, als bestünde eine wirkliche Aussicht auf Besserung für die Armen, die schwarzen wie
die weißen, durch das poverty program. Es gab Experimente, Hoffnungen, Neuanfänge. Dann kam
die Eskalation in Vietnam, und ich mußte zusehen, wie das Programm zerschlagen und inhaltlos
gemacht wurde, als wäre es irgendein politisches Spielzeug in den Händen einer Gesellschaft, die
auf Krieg versessen war, und da wußte ich, daß Amerika niemals die nötigen Mittel oder
Energien für die Rehabilitierung seiner Armen einsetzen würde, solange Abenteuer wie Vietnam
fortlaufend Menschen und Kenntnisse und Geld schlucken wie ein dämonisches, zerstörerisches
Saugrohr. Und so war ich immer mehr gezwungen, im Krieg nicht nur ein moralisches Verbrechen,
sondern auch einen Feind der Armen zu sehen und als solchen zu bekämpfen.
Zu einer vielleicht noch tragischeren Erkenntnis der Wirklichkeit gelangte ich, als mir klar wurde
daß der Krieg weit mehr anrichtete, als nur die Hoffnungen der Armen in der Heimat zu zerstören.
Er schickte ihre Söhne und Brüder und Gatten in den Kampf und in den Tod, und zwar im
Verhältnis zur übrigen Bevölkerung in viel höherer Zahl. Wir nahmen die jungen Schwarzen, für die
unsere Gesellschaft keinen Platz hat, und brachten sie 8000 Meilen weit fort, um Freiheiten in
Südostasien sicher zu stellen, die sie in Südwest-Georgia und Ost-Harlem selbst nicht gefunden
hatten. Und damit stehen wir wiederholt der grausamen Ironie gegenüber, schwarze und weiße
Jungen auf den Fernsehschirmen zu beobachten, wie sie gemeinsam töten und gemeinsam
sterben für eine Nation, die unfähig gewesen ist, sie auch nur miteinander auf die gleiche
Schulbank zu setzen. Wir sehen, wie sie in brutaler Solidarität die Hütten eines armen Dorfes
niederbrennen, und sind uns bewußt, daß sie in Detroit nie im selben Häuserblock wohnen
dürften. Ich konnte nicht schweigen angesichts einer solch grausamen Manipulation der Armen.
Mein dritter Grund geht eine noch tiefere Bewußtseinsebene an, aber er ergibt sich zwangsläufig
aus meinen Erlebnissen in den Negervierteln des Nordens in den letzten drei Jahren -
insbesondere den letzten drei Sommern. Wenn ich mitten unter den verzweifelten,
zurückgestoßenen, zornigen jungen Männern durch die Straßen ging, sagte ich ihnen, daß
Molotow-Cocktails und Gewehre ihr Problem nicht lösen würden. Ich versuchte ihnen gegenüber
mein tiefstes Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, blieb aber bei meiner Überzeugung, daß
soziale Umwälzungen am nachhaltigsten durch gewaltloses Handeln herbeigeführt werden. Aber,
fragten sie, und zwar mit Recht, wie ist das mit Vietnam? Sie fragten, ob unser eigener Staat denn
nicht ganz massive Gewalt anwende, um seine Probleme zu lösen, um die Änderungen
herbeizuführen, die er forderte. Ihre Fragen trafen ins Schwarze, und ich wußte, daß ich nie mehr
meine Stimme gegen die Gewalttätigkeit der Unterdrückten in den Negervierteln erheben konnte,
wenn ich nicht zuerst klipp und klar mit dem größten Gewaltlieferanten der gegenwärtigen Welt
redete: mit meiner eigenen Regierung. Um dieser jungen Leute willen, um der Hunderttausende
willen, die unter unserer Gewalt zittern, kann ich nicht schweigen.
Jenen, die die Frage stellen: "Sind Sie denn nicht ein Bürgerrechtsführer?" - und die mich damit
von der Friedensbewegung auszuschließen meinen - kann ich nur antworten, daß ich zu lange
und zu hart gegen die Segregation in den öffentlichen Einrichtungen gearbeitet habe, als daß ich
nun die Rassentrennung in meinem eigenen moralischen Anliegen zuließe. Gerechtigkeit ist
unteilbar. Es muß auch gesagt werden, daß es doch recht widersinnig wäre, leidenschaftlich und
unerbittlich für integrierte Schulen zu kämpfen und sich nicht um das Überleben einer Welt zu
kümmern, in die sie integriert werden sollen.
Weiter muß ich festhalten, daß etwas im Wesen unserer organisatorischen Struktur der
Christlichen Führerkonferenz des Südens selbst mich zu diesem Schritt bewog. 1957, als eine
Gruppe von uns diese Organisation ins Leben rief, wählten wir das Motto: "Rettet die Seele
Amerikas". Es dürfte also ganz klar sein, daß niemand, dem irgend etwas an der Integrität und
am Leben des heutigen Amerika liegt, den gegenwärtigen Krieg totschweigen kann.
Als wäre die Last einer solchen Aufgabe noch nicht schwer genug, fiel mir 1964 noch eine weitere
Verantwortung zu: Ich kann nicht vergessen, daß der Friedensnobelpreis ebenfalls ein Auftrag war
- ein Auftrag, noch schwerer als je zuvor für die "Verbrüderung der Menschen" zu arbeiten. Dies ist
eine Berufung, die mich aus einer Staatszugehörigkeit heraushebt, aber auch wenn es sie nicht
gäbe, hätte ich immer noch mit der Bedeutung meiner Berufung als Diener am Wort Jesu Christi
zu leben. Für mich ist die Beziehung dieses geistlichen Amtes zum Aufbau des Friedens so
deutlich, daß ich mich manchmal über die Leute wundere, die mich fragen, warum ich gegen den
Krieg spreche. Wir sind aufgerufen, für die Schwachen, für die Menschen ohne Stimme, für die
Opfer unseres Staates zu reden, und auch für die, die er Feinde nennt. Denn kein von
Menschenhand verfaßtes Dokument kann bewirken, daß diese Menschen weniger als andere
unsere Brüder sind. Und wenn ich über den Wahnsinn von Vietnam nachgrüble, wenn ich in
meinem Innern nach Wegen suche, zu verstehen und mitfühlend zu reagieren, gehen meine
Gedanken fortwährend zu diesem Inselvolk. Ich meine hier nicht die Soldaten auf beiden Seiten,
nicht die Junta in Saigon, sondern einfach die Menschen, die nun schon seit fast drei Jahrzehnten
unter dem Fluch des Krieges leben. Ich denke auch darum an sie, weil mir klar ist, daß es keine
dauerhafte Lösung gibt, ehe nicht ein Versuch gemacht wird, sie kennen zu lernen und ihre
unterdrückten Rufe zu hören. Sie müssen in den Amerikanern seltsame Befreier sehen.
Das vietnamesische Volk erklärte 1945, nach der französisch-japanischen Besetzung und vor der
kommunistischen Revolution in China, seine Unabhängigkeit. Es wurde von Ho Chi Minh angeführt.
Obwohl es sich in seinem eigenen Freiheitsdokument auf die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung berief, weigerten wir uns, es anzuerkennen. Unsere Regierung hatte
damals das Gefühl, die Menschen Vietnams seien noch nicht reif für die Unabhängigkeit, und so
wurden sie wiederum das Opfer jener tödlichen Arroganz des Westens, die die internationale
Atmosphäre schon so lange vergiftet. Neun Jahre lang unterstützten wir nach 1945 die Franzosen
kräftig bei ihrer erfolglosen Anstrengung, Vietnam wieder zu kolonisieren. Als die Franzosen
geschlagen waren, sah es so aus, als würden nun über das Genfer Abkommen Unabhängigkeit
und Landreform ihren Einzug halten. Statt dessen hielten die Vereinigten Staaten ihren Einzug,
beschlossen, daß Ho Chi Minh die vorübergehend geteilte Nation nicht vereinigen dürfe, und die
Bauern mußten zusehen wie wir einen der verbrecherischsten modernen Diktatoren, den von uns
auserwählten Premierminister Diem, unterstützten.
Die Bauern sahen zu und duckten sich, als Diem jede Opposition erbarmungslos ausrottete, die
ausbeuterischen Grundbesitzer begünstigte und sich weigerte, die Wiedervereinigung mit dem
Norden auch nur zu diskutieren. Die Bauern sahen zu, wie das alles zuerst durch den
amerikanischen Einfluß und später durch eine wachsende Zahl amerikanischer Truppen geleitet
wurde, die herüberkamen, um den Aufstand, den Diems Methoden heraufbeschworen hatten,
ersticken zu helfen. Als Diem gestürzt wurde, mögen sie froh gewesen sein, doch die lange Reihe
militärischer Diktatoren schien ihnen keine wirkliche Änderung zu verheißen, vor allem nicht in
Hinsicht auf ihr Bedürfnis nach Land und nach Frieden.
Statt dessen erhöhten wir unsere Truppenaufgebote zur Unterstützung von Regierungen, die
außerordentlich korrupt, unfähig und ohne jeden Rückhalt im Volk waren. Die ganze Zeit über
lasen die Leute unsere Flugblätter und nahmen regelmäßig Versprechungen von Frieden und
Demokratie und Landreform entgegen. Jetzt stöhnen sie unter unseren Bomben und betrachten
uns - nicht ihre Mitvietnamesen - als ihren wirklichen Feind. Traurig und apathisch trotten sie
dahin, wenn wir sie vom Land ihrer Väter weg in Sammellager treiben, in denen kaum je den
geringsten sozialen Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Sie wissen, daß sie entweder
mitgehen oder unter unseren Bomben umkommen müssen, und so gehen sie eben mit, voran
Frauen, Kinder und Alte. Sie sehen zu, wie wir ihr Wasser vergiften, wie wir die Ernten ihrer Felder
vernichten, und sie wandern in die Spitäler mit mindestens zwanzig durch amerikanische
Feuerkraft verursachten Unfällen auf eine vom Vietkong zugefügte Verletzung. Sie wandern in die
Städte und sehen, wie sich Tausende von Kindern heimatlos, unbekleidet, wie Tiere, zu Haufen in
den Straßen herumtreiben. Sie sehen, wie die Kinder ihre Schwestern an unsere Soldaten
verkaufen und für ihre Mütter betteln. Was denken wohl die Bauern, wenn wir uns mit den
Grundbesitzern verbünden und uns weigern, den vielen Worten über Landreform irgendwelche
Taten folgen zu lassen? Wo sind die Wurzeln des unabhängigen Vietnam, das wir aufzubauen
behaupten? Unter diesen Menschen ohne Stimme? Wir haben die beiden Einrichtungen zerstört,
die ihnen das Teuerste waren: die Familie und das Dorf. Wir haben ihr Land und ihre Saaten
zerstört.
Wir haben mitgeholfen, eine der einzigen nichtkommunistischen revolutionären politischen Mächte
des Landes, die Vereinigte Buddhistische Kirche, zu zerstören. Wir haben die Feinde der Bauern
von Saigon unterstützt. Wir haben ihre Frauen und Kinder verdorben und ihre Männer getötet. Was
für Befreier! Es ist wenig geblieben, worauf man aufbauen könnte - außer Bitterkeit. Und bald
werden die einzigen übriggebliebenen soliden Fundamente in unseren Militärbasen und in den
Betonbauten der Sammellager, die wir befestigte Dörfer nennen, zu finden sein. Die Bauern
mögen sich fragen, ob wir unser neues Vietnam auf solchen Grund zu stellen gedenken. Könnten
wir ihnen solche Gedanken verübeln? Wir müssen für sie sprechen, wir müssen die Fragen
aufwerfen, die sie nicht äußern können. Auch das sind unsere Brüder.
Eine vielleicht noch schwierigere, aber nicht weniger notwendige Aufgabe ist es, für jene zu
sprechen, die als unsere Feinde bezeichnet worden sind. Wie ist das mit der Nationalen
Befreiungsfront? Wie können sie an unsere Integrität glauben, wenn wir jetzt von "Aggression aus
dem Norden" reden, als gäbe es nichts Wesentlicheres an diesem Krieg? Wie können sie uns
trauen, wenn wir ihnen jetzt, nach der mörderischen Diem-Regierung, Gewalt vorwerfen? Und ihnen
Gewalt vorwerfen, während wir mit immer neuen Todeswaffen ihr Land überschütten? Bestimmt
müssen wir ihre Gefühle verstehen, auch wenn wir mit ihren Handlungen nicht einverstanden sind.
Wie beurteilen sie uns, wenn unsere amtlichen Stellen wissen, daß ihre Mitglieder zu weniger als
25 Prozent Kommunisten sind, und ihnen trotzdem beharrlich diesen Sammelnamen geben? Sie
fragen, wie wir von freien Wahlen sprechen können, wo doch die Saigoner Presse von der
Militärjunta zensuriert und kontrolliert wird. Ihre Fragen sind erschreckend relevant. Will unser
Staat wiederum einen politischen Mythos aufbauen und hinterher mit der Macht neuer Gewalt
abstützen?
Darin liegt die wahre Bedeutung, der wahre Wert von Mitgefühl und Gewaltlosigkeit, daß sie uns
helfen, den Standpunkt des Feindes zu sehen, seine Fragen zu hören, zu wissen, wie er uns
einschätzt. Denn aus seiner Sicht heraus vermögen wir tatsächlich die grundlegenden Schwächen
unserer eigenen Stellung zu erkennen, und wenn wir reif sind, können wir aus der Weisheit der
Brüder, die Gegner genannt werden, lernen, an ihr wachsen und von ihr profitieren. So ist es auch
mit Hanoi. Im Norden, wo unsere Bomben jetzt das Land verwüsten und unsere Minen die
Wasserwege gefährden, begegnen wir einem tiefen, aber verständlichen Mißtrauen. In Hanoi sind
die Männer, die den Staat gegen Japaner und Franzosen zur Unabhängigkeit führten. Sie waren es
auch, die einen zweiten Kampf gegen die französische Herrschaft führten und dann in Genf
überredet wurden, das von ihnen kontrollierte Land zwischen dem 13. und 17. Breitengrad
"vorübergehend" aufzugeben. Nach 1954 erlebten sie, wie wir uns mit Diem verschworen, um
Wahlen zu vereiteln, die mit Sicherheit Ho Chi Minh an die Macht über ein vereintes Vietnam
gebracht hätten, und es wurde ihnen klar, daß sie wiederum die Betrogenen waren.
Wenn wir fragen, warum sie keine Lust zeigen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, dann
braucht man nur an diese Dinge zu erinnern. Und es muß uns auch klar sein, daß die Führer von
Hanoi die Anwesenheit amerikanischer Truppen zur Unterstützung der Regierung Diem als den
ersten militärischen Bruch des Genfer Abkommens über fremde Truppen betrachteten. Sie rufen
uns in Erinnerung, daß sie erst anfingen, Material und Soldaten in großer Zahl einzusetzen, als
die amerikanischen Streitkräfte schon zu Zehntausenden hereingeströmt waren. Hanoi denkt noch
daran, wie unsere Führer sich weigerten, uns die Wahrheit über die früheren nordvietnamesischen
Friedensanträge zu sagen, wie wir behaupteten, es existierten keine, während sie doch ganz klar
gestellt worden waren. Ho Chi Minh hielt die Augen offen, als Amerika von Frieden sprach und
seine Streitkräfte ausbaute, und er hat bestimmt auch jetzt die immer stärker werdenden
internationalen Gerüchte über amerikanische Pläne für eine Invasion im Norden gehört.
An diesem Punkt muß ich wohl klarstellen, daß mich, während ich in den letzten paar Minuten
versuchte, den Stummen in Vietnam eine Stimme zu leihen und die Argumente jener zu verstehen,
die man den Feind nennt, unsere eigenen Truppen dort so sehr beschäftigen wie nur irgend etwas.
Denn ich finde, wir setzen sie in Vietnam nicht bloß dem Verrohungsprozeß aus, der in jedem
Krieg vor sich geht, wo Armeen einander gegenüberstehen und sich zu zerstören suchen. Wir
umgeben ihren Todesmarsch auch noch mit Zynismus; denn sie müssen ja schon nach kurzer Zeit
merken, daß nichts von den Dingen, für die wir zu kämpfen vorgeben, wirklich etwas damit zu tun
hat, und die Kultivierteren unter ihnen sind sich sicherlich klar darüber, daß wir auf seiten der
Reichen und Sicheren stehen, während wir den Armen eine Hölle bereiten.
Wenn wir so fortfahren, wird kein Zweifel mehr in meinem Herzen und im Herzen der Welt darüber
sein, daß wir in Vietnam keine ernsthaft guten Absichten haben. Es wird sich deutlich
herausstellen, daß es unsere Mindesterwartung ist, Vietnam als amerikanische Kolonie zu
besetzen, und die Leute werden es nicht unterlassen können, anzunehmen, unsere maximale
Hoffnung gehe dahin, China zu einem Krieg zu reizen, der es uns erlaubt, seine nuklearen
Einrichtungen zu bombardieren. Irgendwie muß dieser Wahnsinn ein Ende nehmen. Wir müssen
jetzt aufhören. Ich spreche als ein Kind Gottes und Bruder der Notleidenden in Vietnam. Ich
spreche für jene, deren Land verwüstet wird, deren Heim zerstört wird, deren Kultur untergraben
wird. Ich spreche für die Armen Amerikas, die den doppelten Preis von zerschlagenen Hoffnungen
zu Hause und von Tod und Korruption in Vietnam zahlen. Ich spreche als Weltbürger für die Welt,
die voll Bestürzung an dem Wege steht, den wir eingeschlagen haben.
Ich spreche als Amerikaner zu den Führern meiner eigenen Nation. Die große Initiative zu diesem
Krieg ging von uns aus. Auch die Initiative, ihn zu beenden, muß von uns ausgehen. Im Frühling
1967 gab ich bekannt, welche Schritte ich als notwendig erachte, damit das geschehen kann. Ich
möchte dem heute nur noch hinzufügen, daß, obwohl zahlreiche Amerikaner diese Vorschläge
unterstützt haben, die Regierung bislang keinen einzigen anerkannte. Es ist jetzt Zeit für wirkliche
Entscheidungen. Der Augenblick ist gekommen, da unser aller Leben eingesetzt werden muß,
soll unser Volk seine eigene Tollheit überleben. Jeder, der humane Überzeugungen hat, muß sich
über den Protest schlüssig werden, der diesen Überzeugungen am besten entspricht, aber
protestieren müssen wir alle. Es liegt etwas Verführerisches darin, es dabei bewenden zu lassen
und zu dem überzugehen, was in gewissen Kreisen ein populärer Kreuzzug gegen den Vietkong
geworden ist. Ich meine, wir sollen wirklich den Kampf aufnehmen, aber ich möchte jetzt etwas
noch Beunruhigenderes sagen: Der Krieg in Vietnam ist lediglich ein Symptom einer weit
tiefergehenden Krankheit, die im Geist Amerikas steckt.
1957 sagte ein hellsichtiger Beamter in Übersee, es komme ihm vor, als stünde unser Land auf der
falschen Seite einer Weltrevolution. Ich bin überzeugt, daß wir uns, wenn wir auf die richtige Seite
der Weltrevolution gelangen wollen, als Nation einer durchgreifenden Revolution der Werte
unterziehen müssen. Eine wahre Neuordnung der Werte wird uns bald veranlassen, die Ehrlichkeit
und Gerechtigkeit vieler unserer vergangenen und gegenwärtigen Taktiken in Zweifel zu ziehen.
Eine wahre Neuordnung der Werte wird bald mit Unbehagen auf den grellen Gegensatz zwischen
Arm und Reich achten. Mit gerechter Empörung wird sie den Blick über die Meere richten und
sehen, wie einzelne Kapitalisten des Westens riesige Geldsummen in Asien, Afrika und
Südamerika investieren, aber nur, um Profite herauszuziehen und ohne jedes Interesse an der
sozialen Besserstellung der betreffenden Länder, und wird sagen: "Das ist nicht Recht." Sie wird
auf unser Bündnis mit den Großgrundbesitzern Lateinamerikas schauen und sagen: "Das ist nicht
Recht." Die Anmaßung des Westens, der sich einbildet, er habe die andern alles zu lehren und
nichts von ihnen zu lernen, ist nicht Recht.
Eine wahre Revolution der Werte wird Hand an die Weltordnung legen und vom Kriege sagen:
"Diese Art, Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen, ist nicht Recht." Dieses Gewerbe,
Menschen mit Napalm zu verbrennen, die Wohnhäuser unseres Landes mit Witwen und Waisen
zu füllen, giftige Drogen des Hasses in die Adern sonst humaner Völker einzuspritzen, Männer
körperlich behindert und seelisch zerrüttet von finsteren, blutigen Schlachtfeldern heimzuschicken,
das kann nicht mit Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe in Einklang gebracht werden. Eine Nation,
die Jahr um Jahr fortfährt, mehr Geld für militärische Verteidigung als für soziale Aufbauprogramme
auszugeben, nähert sich dem geistigen Untergang. Diese Art von positiver Revolution der Werte ist
unsere beste Verteidigung gegen den Kommunismus. Krieg ist nicht die Antwort.
Der Kommunismus wird niemals durch die Anwendung von Atombomben oder Kernwaffen besiegt
werden. Wir leben in einer Zeit des Umsturzes, überall auf dem Erdenrund lehnen sich Menschen
gegen alte Systeme der Ausbeutung und Unterdrückung auf. Die besitzlose, barfüßige
Landbevölkerung erhebt sich wie nie zuvor. "Die Völker, die im Dunkel wandelten, haben ein
großes Licht gesehen." Wir im Westen müssen diese Erhebung unterstützen. Es ist eine traurige
Tatsache, daß gerade die westlichen Völker, die einst so viel vom revolutionären Geist der
modernen Welt in sich trugen, aus Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit, aus krankhafter Angst
vor dem Kommunismus und in der Neigung, sich der Ungerechtigkeit anzupassen, jetzt zu
Erz-Antirevolutionären geworden sind. Das hat manche dahin gebracht, zu glauben, nur der
Marxismus habe den revolutionären Geist.
So ist nun also der Kommunismus ein Urteil gegen unsere Unfähigkeit, die Demokratie zu
verwirklichen und die Umwälzung, die wir begonnen haben, zu Ende zu führen. Wir müssen über
die Unentschlossenheit hinweg zur Tat schreiten. Wir müssen neue Wege finden, für den Frieden
in Vietnam und die Gerechtigkeit in der ganzen unterentwickelten Welt zu sprechen, einer Welt,
die bis an unsere Türen reicht. Wenn wir nicht handeln, werden wir mit Sicherheit durch die langen,
finsteren und schmachvollen Korridore der Zeit geschleppt werden, welche jenen vorbehalten sind,
die Gewalt ohne Mitleid, Macht ohne Moral und Stärke ohne Einsicht besitzen.
Martin Luther King - Herbst 1967