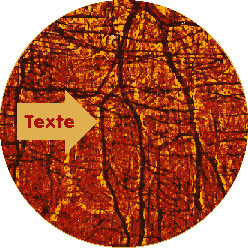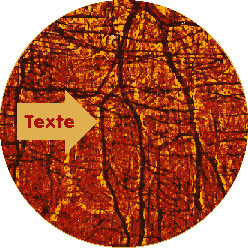Die geplanten Änderungen bei der Entfernungspauschale werden ihr Ziel nicht erreichen
Daß die üblichen Lobbyisten aufjaulen würden, wenn die Bundesregierung Maßnahmen gegen den überdimensionierten
Automobilverkehr einleitet, war klar. Und so mußte man nicht lange warten, als das Finanzministerium am Wochenende
Pläne bestätigte, wonach die Entfernungspauschale für AutofahrerInnen künftig erst ab dem 21. Kilometer gezahlt wird. Der
ADAC kündigte indirekt bereits eine Klage an, die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, die sich und ihre Partei bereits wieder
in der Rolle des "Anwaltes der Menschen" sieht, Widerstand im Bundesrat.
Die Kritik dieser Organisationen ist reaktionär wie sie selbst. Doch auch aus fortschrittlicher Sicht muß man die Pläne
der Bundesregierung in der jetzigen Form ablehnen. Die Neuregelung der Entfernungspauschale ist falsch, wenn auch
aus ganz anderen Gründen, als sie ADAC und Union sehen. Es wäre nämlich durchaus richtig, AutofahrerInnen in
Deutschland zu diskriminieren. Der Autoverkehr ist ein individuelles Vergnügen, dessen Auswirkungen die gesamte
Gemeinschaft negativ zu spüren bekommt. Diskriminierung einzelner AutofahrerInnen heißt in diesem Fall, Schutz aller
anderen und ist vollkommen gerechtfertigt.
Doch das Ziel, den Kraftverkehr zu begrenzen, dürfte so nicht erreicht werden. Mit Recht beklagen
Umweltschutz-Organisationen die Tendenz zur Eigenheimsiedlung auf der grünen Wiese, im Umfeld der
Ballungsräume. Neben der Zersiedlung der Landschaft und dem Flächenverbrauch steht die deutliche Zunahme des
Pendlerverkehrs im Zentrum der Kritik. Doch gerade dieser wird durch die Neuregelung nicht beseitigt. Denn finanziell
schlechter gestellt wird nicht das situierte Bürgertum im Speckgürtel von Berlin, Hamburg oder Frankfurt, sondern
BewohnerInnen der Städte, die sich - ob aus umweltpolitischen Gesichtspunkten oder aus Gründen des Geldbeutels - für
einen kurzen Weg zum Arbeitsplatz entschieden haben. Dem wünschenswerte Ziele einer räumlichen Integration von
Arbeit und Leben würde ein Wegfall der Entfernungspauschale gerade auf längeren Wege dienen, nicht auf kürzeren. Für
Personen, die im ländlichen Bereich tatsächlich und nicht nur vermeintlich auf ein Auto angewiesen sind, könnten
Ausnahmeregelungen geschaffen werden.
Doch auch aus einem anderen Grund ist die Neuregelung fehlerhaft. Sie soll das Vorziehen der Steuerreform finanzieren,
nicht jedoch ökologische Investitionen ermöglichen. Vollkommen zu Recht beklagt die Opposition das schlechte Angebot
des öffentlichen Verkehrs in der Fläche. (Wenngleich sie auch zu vergessen scheint, daß beispielsweise die massiven
Streckenstillegungen in Ostdeutschland unter der Regierung Kohl erfolgten.) Vollkommen zu Recht beklagen NutzerInnen von
Bahnen und Bussen die regelmäßig steigenden Fahrpreise der Verkehrsbetriebe und Stadtwerke. Hier sollten die
eingesparten Finanzmittel zielgerichtet eingesetzt werden. Die Milliarden aus der Streichung der Kilometerpauschale für
AutofahrerInnen (nach dem derzeitigen Modell schätzungsweise 1,5 Milliarden Euro), gemeinsam mit den eingesparten
Geldern der Verkehrs-Folgekosten und der überfälligen Befreiung der Verkehrsunternehmen von der Ökosteuer (allein bei
der Eisenbahn rund 200 Millionen pro Jahr) könnten preiswerteren Zeitkarten, einem ausgebauteren Liniennetz, häufigeren
Taktzeiten dienen.
So könnte sinnvoll verkehrspolitisch und ökologisch umgesteuert werden. Alles andere sind Schnellschüße, die im
Ergebnis womöglich nach hinten losgehen.
Martin Müller-Mertens
Nachveröffentl. aus
www.rbi-aktuell.de