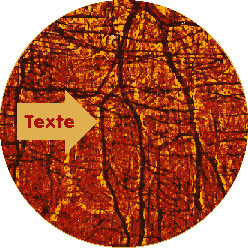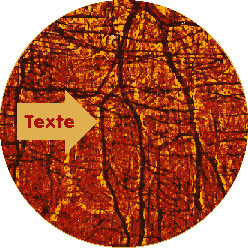Die Folgen der Privatisierung der Wasserversorgung
In Frankreich und England können wir sie bereits heute besichtigen: die Folgen der
Privatisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Sobald die Wasserrechte von
den Kommunen auf große Konzerne übergegangen waren, stiegen die Wasserpreise
kartellartig an. In Frankreich beispielsweise um das Zweieinhalbfache, in England
zwischen 1989 und 1995 um mehr als das Doppelte. Im gleichen Zeitraum stiegen die
Gewinne der Wasserkonzerne um 692 Prozent.1
Ein Nutzen für die Verbraucher war damit nicht verbunden. Im Gegenteil: Die Zahl der
Haushalte in England, denen die Wasserzufuhr gestoppt wurde, weil sie es nicht mehr
bezahlen können, hat seit der Privatisierung um 50 Prozent zugenommen. Globale Konzerne wie
Vivendi, Suez, Pepsi und Coca-Cola haben mit Unterstützung des IWF (Internationaler
Währungs Fond) und der WTO (World Trading Organisation), beides scheinbar unabhängige
Institutionen, die allein dazu dienen, die Vorherrschaft globaler Konzerne zu stärken
und zu sichern, ganze Volkswirtschaften zur Privatisierung des Wassers gezwungen.
Überall war es das gleiche Spiel: Die Opfer werden in die Schuldenfalle getrieben, es
werden neoliberale Zwangsmaßnahmen verordnet und die Konzerne können sich große
regionale Wassermärkte untereinander aufteilen.1
Am heutigen 22. März 2003, dem "Tag des Wassers" ist darüber in den meisten deutschen
Medien nichts zu erfahren. Dabei ist die Situation in Deutschland dramatisch. Viele
deutsche
Kommunen stehen finanziell vor dem Kollaps. Zugleich werden ihnen von US-Konzernen
verlockende Verträge angeboten. Die kommunale Wasserversorgung soll für 99 Jahre an
den US-Konzern verleast und für 29 Jahre (mit Rückkauf-Option) zurückgeleast werden.
Steuervorteile, die das US-amerikanische Recht durch sogenannte Schlupflöcher bietet,
könnten den deutschen Kommunen zunächst viel Geld in die leeren Schatullen spülen.
Da kommt sich mancher kommunale Kämmerer recht clever vor.
Das Geschäft hat gleich einen trendigen Namen bekommen: "Cross-border-leasing". Und
obwohl beispielsweise die Kämmerer der Städte Bochum, Recklinghausen, Gelsenkirchen
und Wesel (Dr. Scholz, Ch. Tesche, R. Kampmann. Dr. Busch) in einer gemeinsamen
Pressmitteilung vom 4. Februar 2003 selbst bemerken: "Die US Cross-Border-Lease
Transaktionen liegen im Interesse der US-Wirtschaftspolitik , die (...) das europäische
Engagement amerikanischer Unternehmen stärken will.", sind sie die vehementesten
Befürworter solcher Geschäfte.
Klar ist, daß die US-Administration bewußt mit steuerpolitischen Maßnahmen diese
Cross-border-leasing-Geschäfte fördert, um den wirtschaftspolitischen Einfluß der
glabal player in Europa auszubauen. Der 'spiegel'
berichtet in einem ansonsten recht kritischen Artikel, in den USA seien schärfere
Gesetze gegen Steuerschlupflöcher geplant.
Cross-border-leasing-Geschäfte stünden seit 4 Jahren auf der schwarzen Liste der
US-Steuerbehörde IRS2. Tatsache ist jedoch, daß gerade
In den letzten vier Jahren das Leasinggeschäft boomt.
In Nordrhein-Westfalen gibt es seit einiger Zeit in den Städten, in denen die Kämmerer
und Ratsfraktionen Cross-border-leasing-Geschäfte planen, bei den BürgerInnen heftigsten
Widerstand.
Die Bereitschaft, ein Bürgerbegehren gegen
das Cross-Border-Leasing zu unterstützen, ist sehr groß.
Viele Menschen glauben den Politikern nicht mehr. Sie glauben deshalb auch nicht, daß
die den Gemeinden aus dem Geschäft zufließenden Dollar uneigennützige Geschenke der
Konzerne seien.
Der BUND in NRW ist ein strikter Gegner dieser grenzüberschreitenden Geschäfte.
Die grundsätzliche Auffassung des BUND ist es, daß gemeindliche Anlagen, mit denen die
Kommunen Dienstleistungen für ihre Bürger erbringen und Aufgaben der Daseinsvorsorge
erfüllen, nicht der Verfügungsgewalt der Kommunen und damit der Kontrolle der Bürger
entzogen werden dürfen.
Am Beispiel der zur Zeit bei den Leasinggeschäften so beliebten Abwasserentsorgungsanlagen
wird sehr deutlich, daß den Gemeinden der Verlust der Verfügungsgewalt und der Kontrolle
über das verleaste Gemeindeeigentum droht und damit den Bürgern die Einflußmöglichkeit
genommen wird.
Die Befürworter der sogenannten Verpachtung von gemeindlichem Eigentum und in letzter Zeit
vor allem von Abwasserentsorgungsanlagen an einen US-Investor kontern:
Die Vorstellungen der Gegner des US-Lease-Geschäftes seien falsch. Das Kanalnetz bliebe
im Eigentum der Stadt und damit der städtischen Verfügungsgewalt und Kontrolle unterworfen.
Das würden die Verträge sicherstellen, die zur Durchführung des sogenannten
Leasinggeschäftes abgeschlossen werden müssten. Das ganze Geschäft bestünde in einem
reinen Hin- und Rückmieten.
Das Märchen vom "reinen" Hin- und Rückmieten
Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, daß es mit dem reinen Hin- und Rückmieten
nicht stimmt:
1. Die Verpachtung der Anlagen an den US-Investor wird für einen Zeitraum von 99 Jahren
abgeschlossen, während die Zurückverpachtung an die Gemeinde nur für höchstens 29 Jahre
erfolgt.
2. Der Hin-Pachtvertrag wird, um seine übergeordnete Bedeutung zu betonen, als
Hauptmietvertrag bezeichnet. Der Rück-Mietvertrag hingegen wird als Mietvertrag
klassifiziert, in englischsprachigen Schriften sogar als Untermietvertrag (sublease).
Das allein spricht schon dafür, daß der US-Investor in dem Lease-Geschäft eine starke
Rechtsposition gegenüber den Gemeinden erhält. Außerdem ist es ein allgemeingültiger
Fakt, daß Laufzeiten von 99 Jahren dem Pächter eine eigentumsähnliche Position verschaffen.
Dazu kommen noch folgende Indizien für die eigentümerähnliche oder eigentümergleiche
Position des US-Investors:
- Der US-Investor erledigt wie bei einem Kauf üblich seine Zahlungsverpflichtung mit der
Zahlung des Gesamtbetrages auf einen Schlag, während die Stadt Mietentgelte zu entrichten
hat.
- Die Stadt erhält für den Zeitpunkt des Ablaufes des Mietvertrages (nach 25 - 29 Jahren)
eine "Kaufoption", mit der sie das Kanalnetz zurückerwerben kann.
Die Verwendung des Begriffes "Kaufoption" macht die Eigentümerposition des
Investors deutlich, denn wenn die Stadt Eigentümer wäre,
brauchte sie die Option zum Kaufen nicht.
- Außerdem ist unbestritten, daß die Steuervergünstigung, die dem Barwertvorteil der
Stadt zu Grunde liegt, nur zustande kommt, wenn nach amerikanischem Recht der US-
Investor als Eigentümer gilt.
Da die Verträge amerikanischem Recht mit New York als Gerichtsstand- und
Unterzeichnungsort unterliegen, hat die Stadt mit Abschluß der Verträge die
Eigentümerposition des US-Investors anerkannt.
Die Vermarktung der Anlagen
Die starke, eigentümergleiche Position des US-Investors gegenüber der Kommune hat sich
dann auch im Rückmietvertrag vor allem im Recht auf vorzeitige Kündigung des
Rückmietverhältnisses im Falle einer Vertragsverletzung niedergeschlagen.
Entscheidend ist dabei, daß der Investor dann die Herausgabe der Anlage verlangen kann.
Was unter der Herausgabe der Anlage zu verstehen ist, wird beispielsweise auf den
Seiten 4 und 5 der Transaktionsbeschreibung (Beschreibung des US-Lease-Geschäftes)
für Recklinghausen dargestellt. Dort heißt es, daß der US-Konzern, um die Anlage in
Besitz zu nehmen und wirtschaftlich zu nutzen, der Kommune ihr Nutzungs- und
Kontrollrecht an der verleasten Anlage bis zum Ablauf des 99jährigen Mietvertrages
entzieht.
Zur Klärung wie es dann mit der Abwasserentsorgung weiter gehen soll, gibt die
Transaktionsbeschreibung für Recklinghausen die Auskunft, daß der US-Konzern die
Anlage durch qualifizierte Dritte oder die Stadt betreiben läßt, oder die Rechte an
der Anlage an Dritte verkauft.
Die Frankfurter Rechtsanwälte Frank Laudenklos und Dr. Claus Pagatzky haben dazu
in der Neuen Verwaltungszeitung Heft 11 folgende Ausführung gemacht: "Der US-Konzern
kann den unmittelbaren Besitz für die Laufzeit des Hauptmietvertrages, d. h. für etwa
70 Jahre an sich ziehen, die Anlage beispielsweise durch Vermietung und Verpachtung
vermarkten und die hierdurch erzielten Erträge vereinnahmen. Damit kann er die
Kommune für die dann noch verbleibende Restnutzungsdauer wirtschaftlich ausschließen
und den Ertragswert des Wirtschaftsgutes realisieren".
Aus der öffentlich rechtlichen Dienstleistung Abwasserentsorgung ist damit ein dem
Prinzip der Kostenminimierung und Gewinnmaximierung ausgeliefertes Gut geworden, das
von einem privaten Monopolisten geliefert wird.
Der Verlust der Verfügungsgewalt ist vorprogrammiert.
Der Kämmerer der Stadt Wesel, Dr. Manfred Busch, einer der vehementesten Befürworter
des Cross-border-leasing behauptet, bei Kündigung des Vertrages durch den Investor
sei eine Übertragung der Verfügungsgewalt gegen den Willen der Stadt nicht durchsetzbar,
sondern es werde vielmehr der status quo vor Abschluß der Verträge wieder hergestellt.
Der "status quo" kann allerdings nur dann wieder hergestellt werden, wenn die Stadt in
der Lage ist, den erforderlichen Rückkaufpreis zu zahlen, und der Konzern sich
freiwillig bereit erklärt, die Zahlung anzunehmen und im Gegenzug die mit dem
Hauptmietvertrag an der Anlage erworbenen Rechte herauszugeben. Dabei ist zu
beachten, daß der Rückkaufpreis Schadensersatzleistungen enthält, die ein Mehrfaches
des Barwertvorteils betragen können.
Von folgendem ist daher auszugehen: Die vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses
(vor Ablauf der 29 Jahre ) durch Kündigung und damit der Verlust der Verfügungsgewalt
und der Kontrolle für die Kommunen sind vorprogrammiert.
Adriana Ascoli
Anmerkungen:
1 Copray, Norbert, 'Der Ausverkauf des Wassers', Publik-Forum Nr. 5 2003
2 'Geschäfte mit LiLo', Der Spiegel, Hamburg, Nr. 9 / 2003