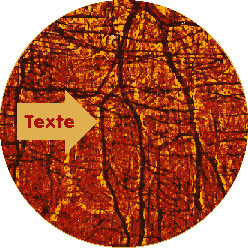Artikel aus der Wochenzeitung 'Die Zeit' (03 / 2001)
von Gero von Randow
Das Uran-Syndrom
Die Politik reagiert lau, die Medien schüren Angst. Und Fakten spielen keine Rolle
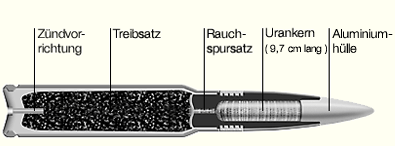
Krisenmanagement ist keine Spezialität dieser Bundesregierung. Da sterben Nato-Soldaten an Leukämie, da ist von radioaktiver Munition die Rede - doch aus
Berlin ist erst gar kein Kommentar, dann nur ein lapidarer, dann ein Hinweis auf die regelmäßige Unterrichtung des Verteidigungsausschusses zu hören. Ansonsten
darf der verunsicherte Bürger ein paar offizielle Dokumente unter www.bundeswehr.de anklicken. Die Menschen haben Angst, auch die Soldaten, aber Rudolf
Scharping muss sich schon sehr zwingen, im Radiointerview das Wort "leider" herauszuquetschen. Wen wundert es, dass da Misstrauen entsteht? Zumal die Erfahrungen
mit der Transparenz in Militärdingen nicht eben vertrauensbildend sind. Gab es nicht die jahrelang vertuschten Schäden durch chemische Kampfstoffe der US-Truppen in
Vietnam?
Die Politik sendete nur spärliche Signale in diesen Tagen. Dafür geriet die "vierte Gewalt" außer Rand und Band. Die Wettbewerber am Medienmarkt überboten einander.
"UNO: Nato vergiftet Kosovo" titelte die taz am vergangenen Wochenende. Doch was hatten die Experten der UN-Umweltorganisation Unep soeben im Kosovo
tatsächlich entdeckt? "Leicht erhöhte Radioaktivität" an einigen Einschlaglöchern; ansonsten habe man "keine größeren kontaminierten Flächen gefunden"
(Unep-Presseerklärung). Gleichwohl, selbst die Süddeutsche Zeitung geißelte einen Verstoß gegen die Genfer Konventionen ("grausame Waffen").
Zu den Erkenntnissen der Massenpsychologie gehört, dass im Falle kollektiver Hysterie alles für möglich gehalten wird - von allen. Sogar im Deutschlandfunk
war zwischendurch von "Plutoniumgeschossen" die Rede, und wer sich die Mühe machte, die Regionalzeitungen zu durchstöbern, entdeckte die abenteuerlichsten
Vermutungen, zum Beispiel diese: Heimlich habe die Nato im Kosovo neuartige Verseuchungswaffen getestet (in Wahrheit wird die Munition seit beinahe 30 Jahren
verschossen). Jeder wollte, jeder musste ausgefallene Ware bieten. Die Welt enthüllte, dass auch in Deutschland mit Uran herumgeballert werde - als wenn das etwas
Neues wäre. Seit 1978 sind US-Flugzeuge vom Typ A-10 auf Truppenübungsplätzen im Einsatz, und dass die Bordkanone auch urangehärtete Munition ausspuckt, war
nie ein Geheimnis.
Grundregel: Die Geschichte nicht "kaputtrecherchieren"
Es gilt die Kosten-Nutzen-Relation. Recherche kostet Zeit - aber es kommt im Journalismus auch darauf an, wer "Erster!" rufen kann; wir erinnern uns an CNN und
die amerikanische Wahl. Und immer lauert die Gefahr, durch allzu genaues Nachforschen seine Geschichte "kaputtzurecherchieren": Ein Wort, das auf
Journalistenschulen gelernt wird. Der stern beispielsweise hatte seine Irak-Reportage, die in der vergangenen Woche erschien, mitnichten kaputtrecherchiert.
Grausige Bilder missgebildeter Kinder und anderer kranker Menschen wurden mit der unbelegten Behauptung kommentiert, die US-Munition sei schuld (und nicht
etwa Saddams Chemiewaffen, der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung, die Umweltschäden oder andere Missstände im Irak).
Nun gibt es, wie stets, Experten und Gegenexperten. Wie soll man da durchfinden? Diese Frage hatten sich die Kollegen von BBC offenbar gar nicht erst
gestellt, als sie vor einigen Monaten eine Schätzung verbreiteten, der zufolge die Munition aus abgereichertem Uran zu 10 000 Krebs-toten im Kosovo führen
werde. Hätte es nicht nahe gelegen, einmal über die Plausibilität nachzudenken? Nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki, der 240 000
Menschenleben auslöschte, starben 420 Menschen mehr an Krebs, als statistisch normal gewesen wäre: Das ist die Auskunft der offiziellen japanischen Krebsstatistik.
Also 420 in Japan und 10 000 im Kosovo? Vielleicht hätte man sich auch den Urheber der Zahlen näher ansehen sollen: Es handelte sich um Roger Coghill,
einen obskuren Biologen, der ansonsten vom Verkauf angeblich heilender "Supermagnete" lebt.
Am besten vertraut man noch auf Leute, die nicht zu einer Konfliktpartei gehören, einen Ruf zu verlieren haben und ohne Geheimhaltung arbeiten. Zum
Beispiel das internationale Unep-Team, dessen Zwischenbericht vom Dezember 2000 jede Verbreitung in deutschen Redaktionen zu wünschen ist
(SSI-News, Vol. 8). Oder das hochangesehene Duo Steve Fetter (University of Maryland) und Frank von Hippel (Princeton). Von Hippel ist ein weltweit
bekannter - und als Fachmann ernst genommener - Aktivist gegen Atomwaffen aus dem Umfeld des nicht gerade staatstreuen Bulletin of the Atomic Scientists.
In ihrer Studie (Science & Global Security, Vol.8, No. 2, 1999), kommen die beiden Atomkritiker zu folgendem Schluss: "Es ist unwahrscheinlich, dass
Kontamination durch abgereichertes Uran irgend einen messbaren Einfluss auf die Volksgesundheit im Irak oder in Jugoslawien haben wird." Grundlage ihrer Studie
sind die wissenschaftliche Literatur sowie Schätzungen und Rechenformeln, die lieber zu viel als zu wenig Risiken annehmen.
Der Innenraum eines getroffenen Panzers wird zur Hölle
Was wurde eigentlich im Kosovo verschossen? Nicht etwa explodierende Granaten, wie die Süddeutsche Zeitung zu berichten wusste, sondern
Munition ohne Sprengwirkung. Ihr harter Kern besteht aus einem knapp zehn Zentimeter langen Stück abgereicherten Urans (depleted uranium, DU) -
Abfall aus der Kerntechnik, weitaus harmloser als die in der Natur vorkommende Uranmischung. Verschossen wird das Zeug von der Bordkanone der A-10,
und zwar abwechselnd mit normaler Munition; meistens enthält jede fünfte Patrone DU. Schwedischen Berechnungen zufolge verschießt eine A-10 pro Angriff
etwa 50 bis 100 Patronen, also 10 bis 20 DU-Stifte, über einem schmalen Geländestreifen von 10 mal 50 Metern.
Die Munition ist panzerbrechend. Sie ändert ihre Materialeigenschaft beim Aufprall und wird zu einer extrem harten Lanze. Anschließend pulverisiert ein
großer Teil des Materials und entzündet sich; im Innenraum des getroffenen Panzers bricht die Hölle los. Den im brennenden Panzer umherfliegenden
Metallstaub konzentriert einzuatmen könnte in der Tat riskant sein - aber wovon reden wir da? Im Golfkrieg mussten 113 US-Soldaten erleben, dass ihr
Fahrzeug von DU-Geschossen der eigenen Truppe zerstört wurde. 13 starben, 50 wurden verwundet: Es wäre, gelinde gesagt, unangemessen, in diesem
Zusammenhang das geringe Risiko einer Verstrahlung zu problematisieren; sie ergäbe laut Unep-Bericht eine Strahlenbelastung, die noch innerhalb der
Schwankungsbreite der natürlichen Belastung liegt. Noch geringer ist die Strahlendosis für jemanden, der während des Angriffs neben einem Panzer steht -
und auch er wird davor am wenigsten Angst haben.
Kurz darauf ist das Pulver dermaßen verteilt, dass es nach den Berechnungen beider Studien radiologisch keine Rolle mehr spielt. Freilich ist Uran ein
Schwermetall wie Blei oder Cadmium, das die Nieren angreifen kann. Bis zum ersten Regen fliegt der Staub durch die Luft, danach wird er an Bodenstoffe
gebunden. Um bis dahin so viel DU-Pulver einzuatmen, dass die Nieren geschädigt werden können, müsste jemand schon eine längere Zeit in der Wolke
stehen bleiben, die von etlichen Geschosssalven hervorgerufen wurde - "ein höchst unwahrscheinliches Szenario", schreiben Fetter/von Hippel. Auch das
Betreten des zerschossenen Panzers gilt als unproblematisch, zumindest wenn eine Schutzmaske getragen wird.
Wenn die Soldaten abziehen, kehren die Zivilisten in die Heimat zurück. Munitionsteile, schwarze Rückstände aus Uranmunition sowie zerschossene und
ausgebrannte Fahrzeuge liegen im Gelände und in Ortschaften herum. Welche Gefahr geht davon aus? Kriegsgenerationen wissen: Munitionsreste muss man
liegen lassen. Wer Uranstücke, die anders als manch andere Geschosse nicht explodieren können, ein paar Tage lang in der Hosentasche trägt, empfängt
eine erhöhte Strahlungsdosis. Zwar droht keine Verbrennung und auch kein messbar höheres Krebsrisiko, schreiben Fetter/von Hippel, aber ein leicht
vermehrtes Risiko könnte entstehen, wenn sich jemand einen Kettenanhänger daraus bastelt.
Gefahr tritt freilich auf, wenn Uranstaub in den Magen-Darm-Trakt gerät - Vergiftungsgefahr, keine Strahlengefahr, es sei denn, jemand isst 30 Gramm
lösliches oder gar 600 Gramm unlösliches Uranpulver (Fetter/von Hippel). Insbesondere Kinder, die an den Einschlagstellen kontaminierte Erde in den
Mund nehmen, sind chemisch gefährdet (Unep-Studie). In den ersten Tagen sollten Tiere daran gehindert werden, an der kontaminierten Stelle zu grasen -
in die Milch oder ins Schlachtfleisch könnte zu viel Schwermetall gelangen (was freilich auch im Fall von Bleigeschossen gälte); ein ähnliches Kurzzeitrisiko
birgt das Grundwasser unmittelbar neben den Einschlagorten. Doch auch diese Risiken wären zu klein, um sie durch statistische Vergleichsstudien erfassen
zu können, schreiben Fetter und von Hippel, und die Unep fügt an, dass die verbleibenden Stäube niemanden daran hindern sollten, in seine Heimat
zurückzukehren. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man die fraglichen Stellen absperren; würden sie anschließend umgepflügt und bewirtschaftet,
verteilte sich das Restgift in ausreichendem Maße (Unep).
Wie alles Wissen ist auch dieses nur vorläufig. Doch angesichts der Gesundheitsgefahren im ehemaligen Kriegsgebiet - von den Minen über
Explosivmunition bis hin zu verbrannten Chemiefabriken und zur zusammengebrochenen Infrastruktur - ist es von ausgemachter Dreistigkeit, das
vergleichsweise winzige Uranrisiko großzuschreiben. Und zynisch obendrein, denn es wird mit der Angst der beteiligten Soldaten gespielt.
Viele Soldaten und ihre Angehörigen wurde in diesen Tagen das "Balkan-Syndrom" fürchten gelehrt. Der Name rührt vom "Golfkriegs-Syndrom"
her: eine Mixtur aus vielerlei Krankheitssymptomen. Jahrelang und mit großem Aufwand wurde in den USA nach den Ursachen gesucht. Außer
Uranmunition kamen infrage: Pestizide, Insektensprays, Saddams Chemiewaffen, brennende Ölfelder, Stress, Impfungen. Nur eine dieser Hypothesen
konnte bisher nicht entkräftet werden: die Verabreichung eines Medikaments gegen Nervengas. Im Irak wohlgemerkt, nicht im Kosovo. Bisher gibt es
auch kein Balkan-Syndrom, und wenn dieser Begriff noch so oft wiederholt wird. Es könnte freilich demnächst auftreten, keine Frage, denn im Einsatzort
wirken viele Gesundheitsgefahren, auch seelische.
Einige Nato-Soldaten sind an Leukämie erkrankt, also an Blutkrebs. Eine grässliche Krankheit, deren Erwähnung bereits Angst einjagt. Doch wer sagt
ihren Kameraden, die sich nun vor Leukämie fürchten, die Wahrheit? Wo lesen sie, wie viele Leukämiefälle statistisch normal sind? Oder dass die bisherigen
Studien über den Uranbergbau, dessen Arbeiter ganz anderen Belastungen ausgesetzt sind, keinen Hinweis auf Leukämie brachten? Auf Lungenkrebs,
das schon, aber der dürfte mit den besonderen Umständen im Bergbau zu tun haben. Und von wem erfahren sie, dass die radioaktiven Dosen aus verschossener
Munition ein Nullum sind verglichen mit der Strahlenlast des Rauchens, eines Urlaubs im Schwarzwald oder eines Interkontinentalflugs? Von ihren Politikern
jedenfalls nicht. Ob in Italien, Portugal oder Deutschland: es stehen Wahlen an. Da mag niemand als Abwiegler dastehen, zu nahe liegt der (irrige) Analogieschluss
aus der BSE-Krise. Also gilt die Parole: Panik et Circenses. Zumal es jemanden gibt, gegenüber dem sie den starken Mann markieren können - die Amerikaner.
Die haben zurzeit ja noch nicht einmal einen richtigen Präsidenten; die Katze ist fort, die europäischen Mäuse tanzen auf dem Tisch.
Die meisten europäischen Verbündeten der Vereinigten Staaten fordern mittlerweile von ihrem einigermaßen verdutzten Partner, auf DU-Munition zu
verzichten, wenigstens vorläufig. Der deutsche Kanzler gehört sogar zu den Wortführern, unterdessen aus dem Bundestag noch ganz andere Töne zu
hören sind: Von "Kriegsverbrechen" spricht Margot von Renesse (SPD) und bringt den Internationalen Gerichtshof ins Spiel - solche Töne kannte man
bisher nur aus dem privaten Staatsrundfunk des Slobodan Milocevic oder den Fernsehansprachen Saddam Husseins, die stets behauptet hatten, die USA
würden ihre Herrschaftsgebiete radioaktiv verseuchen. Jahrelang hatten sie diese Propaganda über das Internet und auf Konferenzen verbreitet, weitgehend
ohne Erfolg.
Nun ist die Lage eine andere. Sie erlaubt es offenbar einigen, ihr schlechtes Gewissen loszuwerden: Ehemalige Friedenskämpfer, die dem Kosovo-Krieg
zugestimmt hatten und jetzt ein entschlossenes "so nicht!" gen Washington schmettern. Während Scharping in den ersten Tagen der Uranhysterie noch
Schwierigkeiten hatte, den Mund aufzumachen, verlangte die grüne Bundestagsfraktion bereits die "internationale Ächtung der Uranmunition" - Frieden
schaffen mit sauberen Waffen.
Dabei wäre von Scharping durchaus etwas zu fordern, von ihm und den anderen Verteidigungsministern der Nato: eine statistische Studie, um
herauszufinden, ob die Balkan-Einsätze eine besondere Leukämiegefahr mit sich bringen - nicht wegen der Munition, sondern zum Beispiel wegen der
Risikofaktoren Benzol (im Treibstoff und hydraulischen sowie Schmierflüssigkeiten) und Viren. Dafür müssten das Alter der Soldaten, ihr Risikoverhalten
(Rauchen!) und etliche Daten mehr erhoben werden, sagt Maria Blettner, die Vorsitzende der Strahlenschutzkommission. Daraus ließe sich die Zahl der zu
erwartenden Leukämiefälle ermitteln. Anschließend müssten die diagnostizierten Leukämien gezählt und bewertet werden - dann erst weiß man, ob es
überhaupt eine Häufung gibt, die weitere Studien erfordert.
Wieso setzt sich kein Politiker dafür ein? Weil es Dringlicheres gibt. Gerhard Schröder muss sein abrutschendes Kabinett in den Griff kriegen, die
Nato-Europäer müssen aufpassen, dass das Bündnis nicht noch mehr Risse bekommt. Das Uran hat einiges durcheinander gebracht. Was sich durchaus
anders ausdrücken ließe: Slobodan Milocevic und Saddam Hussein haben eine Propagandaschlacht gewonnen.